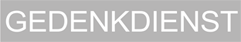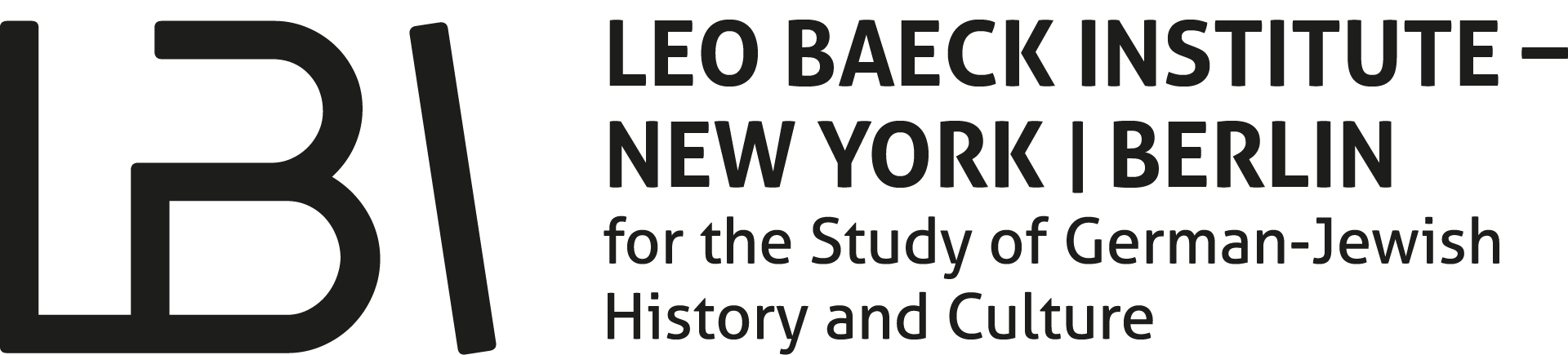|
George | Czuczka |
George Czuczka was born in Vienna in 1925. He lived with his parents in Karl-Marx-Hof, where he experienced the bombardment of the building during the February Uprising in 1934. After the Anschluss, Czuczka’s father was imprisoned for several months in Dachau and Buchenwald. The family fled to the US after his release in March 1939. Czuczka would return to Europe as a soldier in the US Army and later served in Germany, Austria and India for the US Foreign Service. He lived in Washington, D.C. at the time of his interview. |
Full interview
|
Part 1 |
Part 2 |
Part 3 |
Part 4 |
|
Part 5 |
in chronological order
Teil 1
PR: This is an Austrian Heritage Collection interview with Mr. George Czuczka, conducted by Konstantin Wacker and Philipp Rohrbach on June 5th, 2008 in the United States Holocaust Memorial Museum.
GC: Ich wurde am 3. Juli 1925 in Wien, im Sanatorium Loew, geboren. Meine Mutter war eine geborene Felsenburg, mein Vater hieß Fritz Czuczka. Seine Familie stammte aus Mähren, die Familie meiner Mutter stammte aus der Slowakei. Die waren beide in Wien geboren, in den [18]90er-Jahren. Meine frühe Jugend habe ich in Margareten verbracht. Mein Vater war Architekt, er hatte ein Atelier in der Margaretenstraße Nr. 71 und dort wohnten wir zu dritt, ungefähr fünf Jahre lang. Meine Eltern wohnten wahrscheinlich schon vorher dort. Im Jahre 1929 – oder [19]30 – zogen wir um, und zwar in den Karl-Marx-Hof in Heiligenstadt, wo wir eine Dreizimmerwohnung im Erdgeschoss bekamen. Meine Eltern waren beide Sozialisten und haben höchstwahrscheinlich aufgrund ihrer Beziehungen zum sozialistischen…Stadtrat eine solche Wohnung zugesprochen bekommen. Ich ging dann im Alter von sechs Jahren in die Volksschule, die in der Heiligenstädter Straße war, konnte zu Fuß in die Schule gehen, es dauerte ungefähr sechs oder acht Minuten…und blieb dann in dieser Volksschule vier Jahre lang.
Das erste einschneidende Erlebnis, an das ich mich erinnern kann – dort jedenfalls…an das ich mich von dort erinnern kann, war dann die Belagerung vom Karl-Marx-Hof. Mein Vater, der im Ersten Weltkrieg gewesen war, sagte meiner Mutter – weil sie behauptete, dass der Karl-Marx-Hof unter Artilleriebeschuss wäre – das kann nicht sein, man schießt nicht auf bewohnte Gebäude mit Kanonen. Meine Mutter, die nicht im Ersten Weltkrieg war, behielt allerdings Recht, denn es war mit Kanonen auf den Karl-Marx-Hof geschossen worden. Und am nächsten Tag wurden wir dann allesamt in das Polizeikommissariat im Bahnhof Heiligenstadt gebracht und…wahrscheinlich die Akten durchgesehen, man musste sich legitimieren. Und hinter der Tür lagen aufgestapelt die Leichen von den Schutzbündlern und…war natürlich ein sehr starkes Erlebnis für mich. Meine Eltern gingen dann, mehr oder weniger, in den Untergrund und betätigten sich in dieser Art, dass sie den Opfern der Februarunruhen halfen und, dass…meine Mutter beispielsweise war bei den Quäkern tätig und verwaltete für den Karl-Marx-Hof, einen Teil des Karl-Marx-Hofes, die Spenden, die an die Opfer verteilt wurden. Teils Geldspenden, teils Sachspenden, also Kleider, Lebensmittel und so weiter.
1/00:06:05
In dieser Zeit war es für meinen Vater sehr schwer, beruflich weiterzukommen, einfach, weil die Nachwehen von den…vom Börsenkrach sehr hart waren und auch, weil er Aufträge bekommen hatte mithilfe…vielleicht dieser Beziehungen zur Partei oder zur Familie. Und es ging uns eigentlich vor der Emigration meistenteils gar nicht besonders. Und als dann während…der vier Jahre [Engelbert] Dollfuß/[Kurt] Schuschnigg war dann mein Vater aktiv, indem er…so eine Vertriebsstelle…oder Verteiler von illegalen Schriften gemacht hat und manchmal durfte ich auch mitmachen und habe dann in einer alten, verbeulten Einkaufstasche unten die Rote Fahne oder wie das hieß, ausgetragen. Und drüber legten wir dann Geschirrtücher oder Esswaren oder sonst was und ich wanderte dann von einem zum anderen und sagte: „Da bin ich!" Und die wussten schon, was in der alten Einkaufstasche war, nahmen ihres ab und ich bekam dann ein Stück Kuchen oder irgendwas und dann ging ich weiter.
Nun war es so, dass im Karl-Marx-Hof wohnte man…ja es war so, dass…Juden im Karl-Marx-Hof machten einen kleineren Prozentsatz aus als Juden in Wien allgemein und ich glaube, es waren in dem Teil des Karl-Marx-Hofs, wo wir wohnten, waren höchstens fünf jüdische Familien von, was weiß ich, 150 oder mehr. Antisemitismus im Karl-Marx-Hof war nonexistent, das gab es nicht und wir hatten…wir kannten die paar Juden, die da waren. Die waren sowieso Genossen, so wie wir, und in dieser Hinsicht waren die nicht Juden zuerst, sondern Genossen zuerst. Und die anderen waren halt auch Genossen. Und man hat eigentlich…also ich habe mit den Kindern genauso Fußball gespielt, wie wenn das lauter Juden gewesen wären. Und es war auch dann so, dass wie die…oder ich sollte vorausschicken: meine Eltern waren nicht von einer solchen Sorte, dass sie gesagt hätten: „Was in Deutschland sich abspielt, ist uninteressant für uns hier in Österreich.“ Sie waren sich auch dessen bewusst, dass in Wien und in Österreich, Antisemitismus immer schon…dass es das immer schon gegeben hat. Und wir bekamen auch Besuch aus Deutschland, wo…von Flüchtlingen, die dann auch wiederum zu uns und vielen anderen, geschleust wurden, damit man ihnen helfen konnte, damit man sie weiterreichen konnte oder was weiß denn ich. Und diese Leute brachten dann die ersten Geschichten von den Erzählungen von den Konzentrationslagern mit und von den Verfolgungen, zunächst einmal von den politischen Verfolgungen. Und demzufolge waren meine Eltern natürlich sehr wohl im Bilde, was sich da abspielte. Und was ich eigentlich verstehen und nicht verstehen kann, ist, dass sie nicht – sagen wir im Jahr 1936, [19]37 – gesagt hätten: „Gemma [Gehen wir], bevor es zu spät ist!"
1/00:11:50
Wir hatten einen…nach dem Röhm-Putsch kam ein SA…was weiß ich, Hauptmann oder so etwas, der durch Freunde zu uns geschickt wurde, und der sagte dann im Jahr…eben [19]36 oder [19]37: „Sehen Sie sich vor: die kommen. Und wenn die kommen, dann zuerst mal in den Wienerwald verstecken.“ Meine Eltern haben ihm zugehört und sie haben gewusst, was er gesagt hat und nebenbei…ich war damals zehn, zwölf Jahre alt und ich wurde eigentlich nie von solchen Gesprächen ausgeschlossen, war immer dabei, wenn über diese Dinge geredet wurde und sie hätten…also meine Eltern hätten in hindsight, wenn man sich das nachher überlegt…sie hätten vielleicht emigrieren sollen, aber sie haben es nicht getan. Und der Grund, warum sie es nicht getan haben, ist, meines Erachtens, dass sie einfach Wiener waren und Wien ist nun einmal eine Stadt, die einem unter die Haut geht und da will man nicht weg. Und es ist auch Heimat. Und sie haben allerdings, wie dann der Anschluss kam…haben sie keine Minute versäumt, die Vorbereitungen zu treffen für die Emigration. Und mein Vater schrieb dann an einen amerikanischen Freund, der ein…auch Parteigänger war, ein Stockamerikaner…und schrieb ihm: „Sie wissen ja, was da jetzt gespielt wird, können sie uns helfen?“ Und damals war das nicht so, dass man sich an den Computer gesetzt hat, sondern man musste warten, bis ein Flugpost-Brief hinkam und dann wieder zurück. Und der Mann hat uns postwendend ein Affidavit geschickt, der hat gar nicht gewartet. Mein Vater muss ihm wahrscheinlich unsere Daten schon gegeben haben oder vielleicht hatte er…und so hatten wir ein Affidavit, wahrscheinlich von Anfang April und das alles wäre sehr gut gegangen, wenn mein Vater nicht Ende Mai verhaftet worden wäre. Und das war eine Polizeiaktion in Wien von…was sie, glaube ich, politische Juden nannten. Und mein Vater war von der zweiten oder dritten Garnitur und die erste und zweite hatte sich bereits nach…in die Tschechoslowakei oder nach Frankreich abgesetzt. Aber dann kamen eben diese Leute dran. Und er wurde dann verhaftet und einige Tage später nach Dachau gebracht und hat dann, glaube ich, bis zum Herbst…in Dachau verbracht und ist dann von Dachau nach Buchenwald geschickt worden. Und währenddessen sind wir aus der Wohnung ausgezogen und der Kriminalkommissar, den wir schon aus der illegalen Zeit kannten, kam dann einmal vorbei und sagte zu meiner Mutter: „Sagn‘s [Sagen sie] einmal, Frau Czuczka, woins ned [wollen sie nicht] Ihre Möbel verkaufen?“ Und sie sagte: „Ich glaube, wir müssen wohl!“ Und da sagt er: „Ich kauf sie Eana [Ihnen] ab.“ Und war sehr nett und hat sie uns auch zu einem mehr oder minder – wie soll ich sagen – christlichen Preis abgenommen. [Lacht.]
1/00:17:25
Und meine Mutter wurde dann als Köchin angestellt bei einer ungarischen Familie. Juden, die in Döbling wohnten. Und sie nahm mich dahin mit und wir wohnten dann in…eigentlich in besserem Quartier als im Karl-Marx-Hof, denn diese Leute hatten eine hochherrschaftliche Villa. Und auch wenn wir im Dienstbotenteil wohnten…der war auch ganz hübsch. Und ich fühlte mich auf diese Weise ein bisschen schuldig, dass ich, da ja mein Vater im KZ saß…dass ich da mehr oder weniger…wie ein freier Mensch…dadurch, dass diese Leute Ungarn waren, das war exterritorial…und, dass ich dann als freier Mensch…ich musste nicht in die Schule gehen und es war für mich keine wirklich…ich könnte nicht sagen, dass man mich verfolgt hat, ganz im Gegenteil. Außerdem hatte ich das Glück, blond und mehr oder weniger blauäugig geworden zu sein und ich habe auch da keinen so gewalttätigen Antisemitismus erlebt.
Meine Mutter hat dann Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, den Vater rauszukriegen und bekam die Auskunft von der [Israelitischen] Kultusgemeinde, wahrscheinlich oder auch von den deutschen Stellen, wie das zu machen ist. Man sollte alle nötigen Ausreisepapiere kopieren lassen, an die Lagerverwaltung schicken und auch Schiffskarten haben und so weiter. Und meine Mutter hat das dann alles besorgt mithilfe meines Onkels, des Bruders meines Vaters, den es dann später ereilt hat und der in Polen, ich glaube, in Bełżec umgekommen ist. Aber…und was ich dann…meine Rolle bei dieser ganzen Angelegenheit war, dass ich in die Kopieranstalt am Graben ging, es dort kopieren ließ und es dann ein paar Tage später abholte und mir von denen ein großes Kuvert geben ließ und dann draufgeschrieben habe: „An die Lagerverwaltung des Konzentrationslagers Buchenwald. Mit freundlichen Grüßen.“ Nein, nein. Und ich bin dann zur Post in der Herrengasse gegangen und habe es dann aufgegeben, eingeschrieben. Und es wurde gesagt, dass innerhalb von einer Woche, höchstens…sollte dann, wenn die Papiere stimmten, der Häftling freigelassen werden.
1/00:21:12
Und es verging vielleicht eine Woche und es geschah überhaupt nichts. Und meine Mutter ging dann zu ihrer…zu der Hausbesitzerin und fragte, ob sie telefonieren könnte. Und sie hat in Wien die Gestapo angerufen und hat gesagt: „Ich habe folgendes Anliegen…dieses und jenes: was soll ich da tun? Es ist inzwischen nichts geschehen.“ Und der Mann, der ein…offensichtlich ein Österreicher war…es gab Nationalsozialisten in Österreich…der ein Österreicher war, hat ihr gesagt: „Wissen Sie, gnädige Frau, da müssen sie in Berlin anrufen." Und gab ihr aber freundlicherweise den Namen vom dem Referenten in Berlin bei der Gestapo. Und meine Mutter hat – weiß ich was sie getrieben haben mag – hat den Hörer aufgelegt, wieder abgehoben und beim Fräulein vom Amt ein Gespräch bei der Gestapo in Berlin angemeldet. Und innerhalb von einer halben Stunde oder wie immer lange es gedauert hat, kam Berlin wirklich und die…Fräulein vom Amt sagte: „Ich verbinde.“ Und da war schon der Herr Obersturmbahnführer Sowieso. Und meine Mutter trug ihr Anliegen auch noch ein zweites Mal vor und er sagte daraufhin: „Gnädige Frau, ich werde mich dieser Sache annehmen und Sie können versichert sein, dass das in 48 Stunden erledigt ist.“ Und so war es auch: deutsche Gründlichkeit. Und wir bekamen mitten in der Nacht ein Telegramm von meinem Vater aus Weimar, wo er sagte, ich komme am…morgen Früh um 6:35 Uhr am Ostbahnhof an. Und da war er auch. Wir haben dann noch einen Monat in Wien verbracht – er musste sich wöchentlich bei der Gestapo melden – und sind dann über Zürich und Paris nach Cherbourg gefahren und mit einem deutschen Schiff unter der Hakenkreuzfahne mit mehreren hundert KdF‘lern [Mitglieder der NS-Organisation Kraft durch Freude], Urlaubern, nach Amerika gefahren. Und komischerweise war es auch da so: die haben sich absolut korrekt verhalten, also die Mannschaft und auch die…wir sind ja, was damals Touristenklasse geheißen hat gefahren und sind natürlich nicht dem Kapitän vorgestellt worden und auch nicht zum Captain's Dinner eingeladen worden, aber es war eigentlich ganz normal, wie wenn wir eben nach Amerika fahren würden.
Und wie wir in New York ankamen, war unser amerikanischer Freund…es hat einmal einen Film gegeben, der so geheißen hat, Der amerikanische Freund…unser amerikanischer Freund holte uns am Schiff ab und sagte…und wir sagten: „Haben Sie ihr Auto mit?" In Wien hatte er ein Auto und er sagte: „Nein, ich habe überhaupt kein Auto hier in New York. Was würde ich mit einem Auto in New York anfangen? Ich kann es ja nirgends parken.“ Schon damals im Jahr 1938…[19]39…und er sagte: „Nein, ich haben Ihnen ein…kommen Sie, wir gehen hinunter, ich rufe Ihnen ein Taxi.“ Und es war auch gar nicht schwer, es waren…50 Taxis gewartet und er sagte: „Haben Sie Geld?" Und mein Vater sagte: „Ja, wir haben die 30 Dollar, die wir mitnehmen durften.“ „Ach, das wird schon reichen! Auf Wiedersehen!“ Er verschwand in der Menge und kam dann für einen Moment zurück und sagte: „Übrigens, sagen Sie dem Chauffeur 69th Street and Central Park West, The Congress Hotel.“ Na gut, das sagten wir ihm und fuhren dahin. Und kamen dann zum…bei der Rezeption und die sagten: „Ja, ja, wir haben für sie ein Apartment und das kostet zehn Dollar pro Tag.“ Und meine Mutter sah meinen Vater an, mein Vater sah meine Mutter an. Und sie haben nicht gewagt zu sagen: „Hat Mr. Brunswick vielleicht für eine Woche…hinterlegt?“ Und er hat nicht gefragt und Mr. Brunswick hatte auch nicht…und so zogen wir nach einer Nacht aus diesem sehr schönen Hotel am Central Park aus und suchten uns ein möbliertes Zimmer.
1/00:28:10
Ich ging dann hier in die…auf Anraten besagten Mr. Brunswick, er sagte: „Wie viel…der George ist ja schon in Wien in das Gymnasium gegangen, aber fertig hat er es ja noch nicht. Ich finde es wäre am besten, er würde zuerst in die Grundschule gehen und zwar in die letzte Klasse der Grundschule.“ Und das war eine gar nicht schlechte Idee und das habe ich dann gemacht. Habe noch ein halbes Jahr Grundschule gemacht und bin dann…habe dann mein Diplom als Grundschulabsolvent…konnte ein bisschen mein Englisch, das ich bei meiner Tante gelernt hatte, etwas verfeinern und ging dann in die High School, vier Jahre lang in New York, und bekam dann allerdings in der High School gleich zwei Jahre High School angerechnet und war demzufolge mit…dreizehn schon in einer Klasse für Fünfzehnjährige und habe dann drei Jahre oder zweieinhalb Jahre in der High School gemacht und bin dann auch dort mit Ehren entlassen worden. Und da war ich siebzehn und bin mit siebzehn ins College gegangen. Und das war wahrscheinlich…wenn wir damals gewusst hätten, was wir heute wissen, wäre ich vielleicht nicht in das rote College von New York gegangen, nämlich das City College of New York, wo im Grunde genommen nicht nur sozialistische, sondern auch kommunistische Zellen waren. Und wenn man dann später…wenn ich dann später sagte: „I was at CCNY, City College of New York“, dann würden die Leute gesagt haben: „Oh, aha…“, aber es war gar nicht so. Jedenfalls, ich habe dann Chemie studiert dort und dann fing der Krieg an. Und wie der Krieg anfing, war es so, dass man als Universitätsstudent natürlich, wie in den meisten Ländern, zuerst einmal zurückgestellt…dass man weiterstudieren konnte. Und ich habe dann noch ein Jahr studiert, bevor ich wirklich eingezogen worden bin in die Armee. Und war dann drei Jahre lang in der Armee, zuerst bei der Küstenartillerie.
1/00:32:30
PR: Wann sind Sie denn eingezogen worden?
GC: Im Jahr 1944…ja, da war ich neunzehn Jahre alt. Und da wurde ich dann nach Georgia geschickt, wie gesagt, zur Küstenartillerie, so hieß das damals. Aber es war eigentlich dann die Flak, die Fliegerabwehr. Und habe dort meine Grundschulung mitgemacht, wurde dann in die Infanterie versetzt und machte dort einen Intensivkurs in Infanterie…Nahkampf, in Texas. Und eines schönen Tages, eines gar nicht schönen Tages, es hat geregnet und war kalt, wurde ich ins…wie hieß denn das, ins…auf Englisch heißt das orderly room, das ist die Kompanie…da wo der Hauptmann von einer Kompanie sein Büro hat…ah ja, ihr seid ja gar nicht--
PR: --wir sind Zivildiener. [Beide lachen.]
GC: Das ist gut, ihr seid da falsch zu fragen, aber wie heißt denn das? Ordonanz-Zimmer oder sowas. Jedenfalls, der Hauptmann, der der Befehlshaber von dieser kleinen Einheit war, ließ mich zu sich kommen und sagte: „Ich habe hier einen Marschbefehl für Sie – oder für dich. Du sollst nach Maryland!“ Und ich sagte: „Nach Camp Ritchie?“ Und da sagte er: „Es ist eine Geheimorder, ich darf es dir nicht sagen!“ Und da wusste ich, dass es Camp Ritchie sein müsste, denn Camp Ritchie war ja das Lager, wo man die Nachrichtentruppen ausgebildet hat und wo meine Deutschkenntnisse zur Anwendung kommen konnten. Und wie ich nach Camp Ritchie kam, dann war es wirklich irgendwie ganz lächerlich, denn man fühlte sich wie in einem deutschen Armeelager, denn da waren lauter…und noch dazu entweder in einem deutsch-israelischen Armeelager, denn es waren lauter deutsche und österreichische Juden dort. [Lacht.] Und wenn die zum Beispiel die…beim Appell, wenn sie die Namen ausgerufen haben, dann waren das lauter deutsch klingende, meist jüdisch klingende Namen. Und wir wurden ausgebildet, entweder Kriegsgefangene zu verhören oder Foto-, also Luftaufnahmen zu analysieren oder richtiggehenden Nachrichtendienst zu machen in…wenn dann einmal Deutschland besiegt werden würde…und so weiter.
1/00:37:05
Nur hat sich das alles zugetragen im Winter [19]44, [19]45 und wie ich dann mit meinem Training fertig war, hatte der Krieg bereits mit einer Niederlage der Deutschen geendet. So bin ich nicht mehr in den Genuss von Nahkampfhandlungen gekommen. Und wir wurden dann nach…zuerst nach Frankreich in ein quasi Aufnahme- und Verteilungslager gebracht bei Paris und anschließend in den Spessart…nein, nach Bad Schwalbach in Hessen, wo ein größeres Lager war. Das ist ein Kurort in Hessen mit vielen Kurhotels, die dann die amerikanische Armee praktisch alle beschlagnahmt hat. Und da wurden wir dann zunächst mal einquartiert und dann kamen von den verschiedenen Kommandos, die inzwischen von der Militärregierung, die sich inzwischen etabliert hatte in Deutschland…in den Teilen Deutschlands, wo die Amerikaner waren…kamen dann, machten so wie talent search und haben gesagt: „Wir brauchen drei Dolmetscher und wir brauchen fünf Mann für die counter intelligence in Berlin oder für das Dokumentationszentrum in Berlin.“ Und so weiter.
Und nach einiger Zeit wurde ich dann von dort in ein…tatsächlich in den Spessart geschickt, wo eine sehr interessante Gruppe gebildet worden war, die sowohl von der Militärregierung als auch von den Vorläufern des CIA gebildet worden war. Es war eine sehr kleine Gruppe, bestehend aus einer Hilfstruppe, die dieses Etablissement irgendwie versorgt hat, einer Versorgungstruppe von zehn, zwanzig Mann, Koch und so weiter. Und dann eine sehr kleine Gruppe von Ausbildern und von Untersuchungsbeamten. Die Ausbilder waren dazu da, Leute für das Entnazifizierungsprogramm in den einzelnen Militärregierungsstellen auszubilden. Und diese Untersuchungsmenschen waren dazu da, Lizenzen zu erteilen in den schönen Künsten, in der Journalistik, im Verlagswesen, an Leute beim Rundfunk, an Leute, die vertrauenswürdig waren und die mussten zuerst einmal den üblichen Fragebogen ausfüllen. Und dann wurden sie sehr intensiv verhört und zwar von einem ehemaligen französischen Résistance-Mann, einem Elsässer, der Deutsch konnte und von einem New Yorker Psychologen, einem Freudianer. Und es waren nur diese zwei, die haben die Verhöre gemacht. Und dann hat man, mittags vielleicht nicht, aber abends, jeden Abend ein Dinner gemacht mit den Leuten, die gekommen waren, um ihre Lizenz zu bekommen und das war natürlich sehr interessant. Ich war damals immer noch neunzehn, zwanzig Jahre alt und ich war dazu da, wenn diese beiden, der Mann aus New York, der Mann aus dem Elsass, sich nicht einigen konnten: „Ja wir wollen ihm eine Lizenz geben, nein, wir wollen nicht.“ Dann sollte ich, mit meiner Erfahrung aus Camp Ritchie…sollte ich vor Ort noch einmal eine Untersuchung machen, und zwar mit Leuten reden, die diese Leute, die sich da gemeldet hatten, kannten…und die nun zu verhören, ein Protokoll zu machen und dann zurückzukommen und zu sagen: „Das habe ich gefunden, jetzt könnt ihr sehen, ob das mit dem übereinstimmt oder nicht.“
1/00:43:42
Und das war natürlich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe für jemanden, der noch nicht einmal…gerade seine High School fertiggemacht hat. Und die waren sehr nett und waren auch sehr…haben mich absolut als ebenbürtigen Partner angesehen. Und wir haben dann einen Teil des deutschen Rundfunks, des deutschen Verlagswesens und auch Künstler, Musiker dort gehabt und da konnte man auch sehr interessante Einsichten in die differenzierten…wie differenziert die Leute zu der ganzen Sache, der ganzen Nazi-Sache, Stellung genommen hatten und was es ausgemacht hat…wie es war unter so einem System wirklich zwölf Jahre lang zu leben und wie…wer umgekippt ist und wer nicht, wer wirklich Widerstand geleistet hat und wer nur passiven Widerstand geleistet hat. Wer sich zum Beispiel von seiner jüdischen Ehefrau getrennt hat und wer nicht…und die ganzen moralischen und politischen…Verwirrungen zu verstehen.
PR: Viel Verantwortung für einen jungen Mann.
GC: Ja, ich meine, ich habe es ja nicht allein gemacht, aber ich habe jedenfalls eine sehr gute Erziehung und Informations-Sammlung machen können und bin dann, nachdem diese Sache irgendwie ihren Zweck erfüllt hatte…wurde das aufgelöst und ich ging dann zu den Kriegsverbrecherprozessen. Und da kam ich, wie vor mir mein Vater, nach Dachau, nur eben auf der anderen Seite vom Zaun. Und mein Vater lebte zu der Zeit noch, hat auch noch eine ganze Weile danach gelebt und es war für ihn natürlich eine sehr große Sache. Genugtuung…weiß ich nicht, aber es hat ihn schon aus…er wusste, was das bedeutet und ich wusste, was das bedeutet. Und ich habe dann die anderen hinter dem Stacheldraht gesehen und es waren…waren alles SS-Leute, fast alle, oder eben sonstige Nazis, so richtige Ausübende.
1/00:47:30
Und auch da…ich meine, es ist nicht eine Frage von relativieren. Es hat keinen Sinn zu relativieren, aber auch da: Wenn du nicht ein Viech [Vieh] bist, dann weißt du ja doch – oder glaubst du zu wissen – wie das sein kann oder muss, wenn man jemanden hinter Stacheldraht sitzen lässt und einmal im Monat oder einmal in der Woche einen Brief schreiben lässt. Und natürlich haben wir sie besser behandelt – nicht wie in Abu Ghuraib, bestimmt nicht –, aber sie haben nicht gewusst, wann ist das nächste Verhör, wie wird der Mensch mich behandeln. Und wenn man doch den einen oder anderen zusammengeschlagen hat, wird irgendjemand wissen, was…dass mir das oder jenes geschehen ist. Oder wenn einer vielleicht, ich weiß nicht, ob man…ob es Einzelhaft gegeben hat. Die waren meistenteils in Baracken, haben so gut zu essen bekommen, wahrscheinlich nicht viel schlechter als wir. Der Fraß, den wir bekommen haben, war auch nicht so gut. Aber andererseits habe ich dann auch das Vergnügen gehabt, bei dem sogenannten zweiten, glaube ich, Buchenwald-Prozess dort zu sein, in Dachau – er wurde ich Dachau verhandelt. Und das war der Prozess, wo diese Ilse Koch war, die aus getöteten Häftlingen…aus der Haut von den Häftlingen Lampenschirme hat machen lassen. Da hat man dann eben…erstens einmal habe ich einen Mann auf der Anklagebank gesehen, von dem mein Vater mir erzählt hatte. Ein, ich glaube, Obersturmführer und was der für ein gemeiner Hund war. Und es war ganz nett, jeden Tag oder zweiten Tag hinzugehen und den in Häftlingskleidung zu sehen und etwas betrübt dazusitzen und zu wissen, dass der meinen Vater gequält hat. Mein Vater wurde damals in Buchenwald an den sogenannten…einmal hat er 25 mit dem Ochsenziemer bekommen und ein anders Mal ging es ihm noch wesentlich schlechter. Er wurde an den sogenannten Baum gehängt auf eine Stunde. Mein Vater war übrigens einer, der, obwohl er Schweigegebot bei der Entlassung erteilt bekommen hatte…er stieg aus dem Zug aus und fing an zu reden und hat dann, glaube ich, die nächsten 24 Stunden nur geredet. Und der [Sigmund] Freud hat meines Wissens auf Englisch immer gesagt: „The talking cure.“ If ever there was a talking cure…das war seiner, denn er hat wirklich das alles herausgespuckt, was er da erlebt hatte. Und ich wusste alles über seine Zeit in Dachau und in Buchenwald, so wie ich schon über seine drei Jahre im Ersten Weltkrieg wusste und über die illegale Zeit. Also mir konnte keiner was vormachen über diese Sache. Aber nichtsdestoweniger, es war ganz schön, diese Kerle da auf der Anklagebank zu sehen.
1/00:52:20
Da ging ich dann noch von Dachau weg und wir gingen dann nach München und machten da so mehr Dokumentation – praktisch die Arbeit, die ihr hier macht, also Dokumentation über SS…SS-Schandtaten, Gräueltaten. Aber dann war es genug und ich hatte inzwischen meine Frau kennengelernt, schon da im Spessart, und wir haben dann geheiratet und sind zurückgekommen nach Amerika. Ich bin zurück ins College gegangen, habe Journalistik studiert und bin dann 1950 endlich mit meiner Schule fertig geworden. Bin dann noch zwei Jahre in eine postgraduate school gegangen in New York, die von der Frankfurter Schule gegründet worden war, die New School for Social Research, habe aber dort nicht abgeschlossen, sondern mir einen Job gesucht und landete bei der Voice of America. Wiederum, um mein Deutsch nicht zu verlernen und blieb dann bei der Voice in New York von [19]51 bis [19]55, zog mit der Voice nach Washington, war ein Jahr in Washington und war während dieser Zeit beim deutschen Dienst. Es gab damals noch einen österreichischen Dienst, aber ich wurde zum deutschen Dienst beordert und habe dann dort meinen österreichischen Akzent bis zu einem gewissen Grad verlernt und mir meinen deutschen bis zu einem gewissen Grad angeeignet. Allerdings, wenn ich mich auf Band höre und hörte, merke ich, dass ich genauso Österreichisch spreche wie eh und je. Aber mein…unser sogenannter Producer, der ein deutscher Schauspieler war, ein Berliner Schauspieler gewesen war, hat mir gesagt: „Schon gut, du machst es gut, Georgy.“ [Lacht.] Ich konnte mich für einen Bayern ausgeben, aber einen richtigen Norddeutschen nicht und…obwohl meine Frau Norddeutsche ist.
Dann ergab sich eine Möglichkeit in den Auslandsdienst zu gehen und ich blieb aber der deutschen Sprache immer treu – eigentlich bis auf meinen letzten Job bei der Regierung – und kam zum RIAS [Rundfunk im amerikanischen Sektor] nach Berlin und machte dort nicht…ich habe einige, also bei der Voice habe ich Kommentare und Features und Feuilletons geschrieben. Beim RIAS habe ich noch eine kleine Sendereihe gemacht, die aber ganz und gar unpolitisch war und habe mehr als Redakteur gearbeitet. Das heißt, wir waren fünf Amerikaner und haben eine Belegschaft von, ich glaube, 400 Deutschen gehabt und ich hatte das Kulturprogramm zu betreuen. Das heißt, ich musste die Manuskripte lesen und so wie die Russen es jetzt bei [Wladimir] Putin machen: Man musste sehen, dass alles schön linientreu war [Lacht.] Und dass man halt nicht irgendwas durchgehen lässt, aber es war eigentlich recht liberal. Wir waren nicht so…die haben nicht versucht, einem etwas unter die Weste zu jubeln und wir haben nicht versucht, sie kurz- und kleinzuschlagen. Es war ein ganz nettes Verhältnis, die haben mehr oder weniger die Parteilinie vertreten und wir haben mehr oder weniger weggeguckt, wenn sie es nicht getan haben.
1/00:57:56
Und dann war ich vier Jahre lang in Berlin. Da war Berlin geteilt, vor der Mauer noch, und dann übernahm ich ein Amerikahaus in Westdeutschland, in Essen. Und muss sagen, das war an sich die interessanteste Zeit, weil das nicht alles so vorgekaut und vorgegeben war und man selber kreativ…mit Grenzen…halt kreativ sein konnte und ein breit gefächertes Programm machen und nicht nur von der Zentrale gefüttert…sondern das, was du selber eben für richtig hältst für dieses Gebiet, für diesen Ort. Das war ganz lustig. Ja und dann…in der Zwischenzeit bin ich immer wieder mal nach Washington gekommen und war dann auch wieder bei der Voice. Und dann…ich wusste schon, dass ich in Frühpension gehen wollte, denn ich hatte es bis hier vom Staatsdienst…insbesondere auch zurzeit vom Vietnamkrieg. Ich meine, der Nixon…der Eisenhower war schon schlimm genug und an und für sich war der Truman auch nicht so besonders, aber immerhin, da konnte man noch die Nase zuhalten und sagen: „Ist ja wenigstens einer von der alten Clique!“ Aber die Atombombe habe ich ihm eigentlich nie verziehen. Und den Nixon kannte man ja schon von vorher, bevor er hier Präsident war. Und, ich meine, das war so, wie wenn der [Ignaz] Seipl den [Kurt] Schuschnigg, der [Engelbert] Dollfuß den Seipl ersetzt oder der Schuschnigg den Dollfuß, das ist ja alles dasselbe. Und dann kam eben der Krieg noch und das…ich konnte das nicht wirklich vertreten. Ich hätte auch…wie mein Vater im Jahr [19]36 nicht emigriert ist, bin ich nicht 1970 in den Ruhestand getreten. Ich habe gewartet, bis ich meine Pension bekommen habe, aber es war ein absoluter Grund zu gehen, obwohl viele Leute gesagt haben: „Du hättest ja…könntest ja bis 65 dableiben!“ Und das hätte ich auch können, aber…das war nicht so.
1/01:01:42
Also ich bin gegangen, habe dann in dem Ruhestand, der ja schon seit 30 Jahren andauert…habe ich Übersetzungen gemacht und selber geschrieben und ein paar Sachen verlegt auch und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Wollte sagen, dass…ich habe meinen Teil eigentlich getan und meine Pflicht diesem Land gegenüber. Habe immer treu gedient und bin dem Land auch bei Gott dankbar, dass man aufgenommen worden ist und dass man hier durchaus ein anständiges Leben führen konnte und einen Beruf ausüben. Und ich glaube, dass ich diese 30 Jahre aber nicht vertan habe, weil man…ich habe einerseits, würde ich so sagen: Ich habe meine Gesinnung nie verloren. Und ich halte das für ein Plus. Und außerdem würde ich auch sagen: Ich habe wahnsinnig viel dazugelernt. Dass Leute mit, sagen wir mit 50, aufhören, einen Beruf auszuüben und dann…oder aber einen Beruf aufgeben, nur um sich umzudrehen und wieder praktisch dasselbe zu machen, nur dann beim zweiten Mal mehr Geld zu verdienen, das finde ich eine…da würde ich wirklich sagen, dass man die Zeit, die man hat und die einem gegeben wird, richtiggehend verschwendet. Aber ich glaube, dass, wenn man…mit offenen Augen und offenen Ohren lebt, dass man doch irgendwo einen Beitrag leisten kann und wenn schon gar nicht in der engeren Familie und wenn schon gar nichts anderes, bei sich selber…Punkt. [Lacht.]
Ende von Teil 1
Teil 2
PR: Die erste Nachfrage, die ich an dich hätte ist zur Belagerung des Karl-Marx-Hofs. Da hast du ja gesagt, dass das das erste einschneidende Erlebnis war, an das du dich erinnern kannst – politischer Natur. Wo hat sich dieses ganze Gespräch zwischen deinen Eltern abgespielt? Weil du hast gesagt, dass deine Mutter deinem Vater gesagt hat: „Der Karl-Marx-Hof wird beschossen". Aber ich weiß nicht, wo sich das abgespielt hat.
GC: Das kann ich dir genau sagen. Es spielte sich ab in dem Doppelbett meiner Eltern und ich lag in der Mitte zwischen ihnen und es war Nacht und einerseits war eine…ich weiß nicht, wie viele Maschinengewehre direkt auf der Straße aufgestellt gewesen. Die Maschinengewehre haben…wir waren im Erdgeschoss und die Maschinengewehre haben an unserem Haus vorbeigeschossen und die haben maschinengewehrmäßigen Lärm gemacht und dazwischen waren diese dumpfen Schläge und Einschläge von den Kanonen. Haubitzen waren es eigentlich. Und wir wohnten in einem Teil, der an sich keine Treffer abbekommen hat. Aber ungefähr, würde ich sagen…100 Meter oder 150 Meter von dort, wo unsere Wohnung war, war ein…ist auch heute noch – oder heute wieder – eine Durchfahrt…führt eine kleine Straße durch den Karl-Marx-Hof und da ist ein Torbogen. Und dieser Torbogen wurde immer genannt der Blaue Bogen, weil er blau war. Und direkt gegenüber von dem Blauen Bogen liegt das Fußballstadion von der Vienna, wo ich oft war als Kind. Und das ist eine Anhöhe und dort oben standen die Haubitzen und die haben auf den Blauen Bogen geschossen, weil…sagten sie damals, später…weil sie glaubten, dass dort ein Nest war, ein Widerstandsnest, wo irgendwie auch Maschinengewehre oder was…sich verschanzt hatten. Und was sie gesehen hatten in der Nacht…und es muss eine sternenklare Nacht gewesen sein, ich weiß es jetzt nicht mehr…aber auf jeden Fall, es hat sich etwas in dem ersten Stock oder zweiten Stock von diesem Blauen Bogen gespiegelt und man sagte, dass sie das für dieses Maschinengewehrnest oder sonst was gehalten haben. Aber es war eigentlich eine zahnärztliche Praxis und es waren irgendwelche Geräte in der zahnärztlichen Praxis, die sich in irgendeinem Licht gespiegelt haben und die sie…vielleicht haben sie es auch für Lichtsignale gehalten und sie haben…der Blaue Bogen war völlig zerschossen am nächsten Morgen. Und mein Vater, der dann eines Besseren belehrt, aber als Weltkriegsteilnehmer, ging dann aus einem wohl nur ihm bekannten Grund sozusagen spazieren und ging dann hinauf zu den Haubitzen, zum…Bundeswehr hieß es ja damals…und sprach mit den Offizieren.
2/00:04:59
Er wusste ja, wie das war. Er war ja im Krieg gewesen. Und er sagte dann zu denen wahrscheinlich so etwas: „Sagen Sie einmal, haben Sie eigentlich mit den Haubitzen da auf das Haus geschossen?“ Und die haben gesagt: „Jaja, das hamma g‘macht [haben wir gemacht].“ „Und da drüben, sehen‘s [sehen Sie] da oben!“ Und das ist dann im vierten oder fünften Stock und da war auch noch ein Dachboden oben. „Da bei diesen Luken, da sitzen‘s [sitzen sie] alle!“ Und der Mann – das wurde dann ein geflügeltes Wort bei uns –, der Offizier, der Kommandierende oder was, sagte: „Schauen‘s eana des an [Schauen Sie sich das an], da der Oberstock, der wird obrasiert [abrasiert]!“ „Der wird abrasiert!“, das haben wir dann immer wieder so als geflügeltes Wort bemüht, wenn Tabula rasa gemacht werden sollte. Und mein Vater kam dann zurück und berichtete, war also Frontberichterstatter…konnte er uns das mitteilen. Und am nächsten Tag…ja, ich hatte sogar an dem Tag…war ich von der Schule zuhause. Ich hatte die Mumps und meine Eltern waren beide weg. Und die hatten aber ein Radio und sie…ich durfte sogar in meines Vaters Bett schlafen oder ruhen, weil dort das Radio war. Und ich habe Radio gehört. Und plötzlich ging das Radio…war das Radio tot und ich war nicht so kundig, dass ich sofort zum Lichtschalter gegangen wäre und geschaut hätte, sind alle anderen Lichter auch aus. Und hatte irgendwie Angst, dass ich da irgendwas falsch gemacht habe und dass das Radio deshalb quasi kaputt gegangen ist. Und es war natürlich nicht so, sondern es war ein Generalstreik und meine…ja, dann kamen meine Eltern nach Hause und dann war das alles schon klarer. Und die Straßenbahn fuhr nicht und so weiter.
Aber am nächsten Tag war es dann so, dass sie…dass das Bundesheer mit Haubitzen nicht von der Hohen Warte geschossen hat, sondern von der Bahn, von der Franz-Josephs-Bahn. Und da sagte mein Vater…da wusste er schon, dass es Haubitzen waren…und da sagte mein Vater: „Wir müssen“, – so wie hier jetzt bei einem Tornado –, „weg von den Fenstern und in den innersten Raum der Wohnung!“ Und wir sind dann in einen Korridor gegangen, wo überall zwischen uns und der Außenwand andere Wände waren. Und da wurde der Karl-Marx-Hof von der anderen Seite, also nicht unserer Seite, von der anderen Seite bombardiert. Das war ein ganz gehöriges Trommelfeuer, das ging eine ganze Weile. Ich weiß nicht, eine halbe Stunde, eine Stunde vielleicht, aber jedenfalls: es war eine richtiggehende Belagerung. Es war so…würde ich sagen, der Februar [19]34 für uns damals war…wird ein bisschen so gewesen sein, in der psychologischen Wirkung, wie 9/11 hier, denn es war unglaublich…unmöglich, dass eben…was mein Vater sagte: „Man schießt nicht mit Kanonen auf ein bewohntes Gebäude – schon gar nicht im Frieden!“ Und deshalb muss das schon ein ganz gehöriger Einschnitt gewesen sein in meinem Leben und auch in dem Leben meiner Eltern und von 10.000 anderen natürlich. Dass es einen Staat gibt, der so etwas machen würde. Und das alles im Angesicht von dem, was inzwischen in Deutschland passiert war. Also, das ist schon…
2/00:11:13
PR: Wie haben denn die Eltern erklärt – also währenddessen, während ihr mitbekriegt habt, was da geschehen ist – wie haben sie es denn erklärt, was da überhaupt passiert? Wart ihr euch im Klaren darüber, was da jetzt geschieht, warum das geschieht?
GC: Natürlich. Ich meine, es war die…der Gegenschlag von der Regierung oder vom Staat, war…wie sagt man…disproportional. Du musst dir eben vorstellen, dass jemand wie ich war nicht so ein…jungfräuliches Waisenkind. Wie gesagt, ich war immer mit dabei, wenn meine Eltern über diese Sachen geredet haben und ich wurde auch…die Bücher, die ich gelesen habe, also Kinderbücher, die ich gelesen habe, waren alle links. Und wenn sie nicht sozialistisch waren, waren sie kommunistisch. [Lacht.] Und man hat diesen Leuten schon einiges zugetraut und man wusste ja, was für Leute sie waren. Und es ist nicht so, dass ich jetzt mit 80 Jahren so rede, wie wenn ich damals ein clairvoyant gewesen wäre oder meine Eltern. Es war einfach so. Und es waren die Freunde von meinen Eltern und die – mehr oder weniger – Großfamilie meiner Eltern und die Bekannten meiner Eltern. Die waren alle…haben alle so geredet und gedacht wie wir. Und es war vielleicht der Jammer, dass man über das hinaus nicht die Bevölkerung beeinflussen konnte.
Und das war ja wahrscheinlich wirklich einer der Gründe, warum die Sozialdemokratie in Österreich damals untergegangen ist. Weil die Sozialdemokraten damals eine mehr oder weniger verschworene Gemeinschaft waren, die dann, so wie man hier sagt: „They were preaching to the choir.“ Und du hast halt so und so viele Abonnenten von der Arbeiter-Zeitung gehabt und so und so viele vom Kleinen Blatt und du hast Schulungsabende gehabt und Parteibücher und was weiß ich alles. Aber deep down konnten sie vielleicht nicht über Wien hinaus. Und draußen auf dem flachen Land fast nicht, außer in den Industriezentren, sowie sie eben damals waren oder in den Gruben in der Steiermark. Aber es ist einfach nicht…die Breitenwirkung hat gefehlt, glaube ich. Und die Führer waren außerdem wahrscheinlich…was sie ja schon 1927 bewiesen hatten…die Führer waren nicht in der Lage wirklich dem Volk zu vertrauen, dass das Volk ja losschlagen wollte und einen Sturz herbeiführen…Revolution oder was auch immer. 1934 waren es auch die Führer, die nicht mitgespielt haben. Und es hat in Linz anfangen müssen und nicht in Wien. Und [19]27 war es ja letztlich genau dasselbe. Aber andererseits, was mich betrifft, da gab es keine zwei Möglichkeiten. Und es gibt natürlich viele Wiener, ob sie nun Juden waren oder nicht…bei den Juden ist es noch schwerer verständlich…aber es gab viele Wiener, die gesagt haben: „Das geht schon vorüber.“ Oder: „Man kann ja ned [nicht], und die da oben.“ Aber ich weiß nicht, es hätte wahrscheinlich irgendwie hingekriegt werden können, aber das mit der Regierung, die damals war…und sich auf den Mussolini zu verlassen…da war nicht sehr viel zu machen…next question.
2/00:17:26
PR: Als der Karl-Marx-Hof beschossen worden ist, hat es auch eine Reihe von Kämpfen zwischen Leuten, die im Haus selber gewohnt haben und dem Militär, der Polizei und den Heimwehren gegeben?
GC: Wahrscheinlich, aber direkt involviert waren wir da nicht. Es war so, dass die Leute in der Zeit…dass da eine gewisse Solidarität unter den Bewohnern war, das könnte ich schon…daran kann ich mich schon erinnern. Dass die Leute, mit denen man verkehrt ist, dass die auch weiter – man hat dann immer gesagt – anständig geblieben sind, das war wirklich so. Es sind die wenigsten in unserer näheren Umgebung…sind die Wenigsten umgefallen. Es war dann…nach einer gewissen Zeit bin ich ja ins Gymnasium, nein, da war ich ja schon im Gymnasium. Nein, dann bin ich ins Gymnasium gekommen. Und da mussten wir dann in diese…vaterländische HJ [Hitler-Jugend] eintreten beziehungsweise in die richtige HJ nicht…musste man nicht. Aber es war schon ein bisschen schwierig zu sagen…so, wie der [Barack] Obama keine amerikanische Fahne im Knopfloch hatte…wenn du dann in die Schule gekommen bist…und das war das Klostergymnasium im 18. Bezirk…wenn du da in die Schule gekommen bist und hast nicht dieses Abzeichen gehabt, dann war das schon irgendwie suspekt. Und ich glaube, mein Vater hat fest…ist fest geblieben drei Jahre lang…also im letzten Jahr dann hat er gesagt: „Dann mach es halt, wir wissen ja!“ Dann habe ich es auch getragen, dieses Abzeichen. Aber es war eigentlich auch unter den Mitschülern nicht so. Es war halt auf Wienerisch gleichgeschaltet und man hat es halt gemacht, warum…ob man daran glaubt oder nicht, war ja gar nicht so wichtig. Und dann natürlich in den letzten Monaten im Gymnasium, da kamen dann die illegalen Nazis richtig raus, sie waren vorher schon…es gab dann diese Art von Stutzen, die man getragen hat, also die sie getragen haben. Das waren so weiß gestrickte Kniestrümpfe, die aber nur die Hälfte des Unterschenkels bedeckt haben. Wenn einer so etwas getragen hat, dann war er ein Nazi, das war ihr Kennzeichen. Und die Mädchen…es war sogar eine gemischte Schule…die Mädchen haben Zöpfe getragen, meist blonde Zöpfe und da wurde es dann schon etwas anders. Da war dann auch Antisemitismus mehr…öffentlich…offener als vorher.
2/00:22:14
Kurz vor dem Anschluss war die Schwester von einem Mitschüler von mir im Gymnasium…und das war da so im Vestibül von dem Gymnasium, wo jetzt eine Marmortafel mit den jüdischen Schülern hängt. Und die kannte ich vom Sehen und die war in einer oberen Klasse, der fünften oder sechsten. Und wir trafen uns gewissermaßen im Vestibül. Wir haben nie miteinander geredet, aber sie wusste, wer ich war. Und sie…wir trafen uns und ich habe sie nicht angelächelt, denn ich fand sie gar nicht zum Anlächeln, aber ich wollte einfach vorbei. Und die hat mir zwei Ohrfeigen gegeben, die sich wirklich gewaschen hatten. Für nichts, nur so halt. „Du Saujud“, hat sie gesagt. Und damit hatte ich zwei kleben und Schluss. Und das war vor dem Anschluss.
PR: War es das erste Mal, dass du mit Antisemitismus konfrontiert worden bist?
GC: In dieser Art. Also tätlich ist nie jemand geworden. Ja, so mit: „Jud, Jud, spuck in Hut“ und solche Sachen, das schon, aber das war so dummes Zeug. Und wie gesagt, der Karl-Marx-Hof war so eine Art Enklave. Ich glaube, dass Leute, die in anderen Teilen von Wien gewohnt haben, viel eher konfrontiert worden sind. Und dann eben auch wieder meine schönen blauen Augen oder blonden Haare. [Lacht.]
PR: Du hast ja von dir aus, als du die Geschehnisse im Karl-Marx-Hof und die Bombardierung des Karl-Marx-Hof – oder den Beschuss – beschrieben hast, selber den Vergleich mit 9/11 herangezogen. Kannst du ein bisschen näher ausführen, was du damit gemeint hast?
GC: Ja, ich würde denken, es war, was man auf Englisch nennt: the end of innocence. Und was ich damit meine ist, wenn auch das Leben im Karl-Marx-Hof nicht irgendwie verklärt ist in der Erinnerung, dass es…und ich habe es auch eine Enklave genannt…es war ein Leben unter Gleichgesinnten und ein Leben in einer gewissen Art von Frieden. Österreich war zu dieser Zeit gewiss nicht das glücklichste Land der Welt, aber es war doch ein Land, das friedlich vor sich hinlebte. Die Machtergreifung in Deutschland hatte schon Wellen geschlagen, in unserer Familie zumal, aber es war immer noch so, dass…schließlich und endlich war ich ja ein Kind von zehn Jahren. Und trotzdem: es wirken sich die Besorgnis und die…anxiety…also die Besorgnisse der Eltern und anderer Leute, mit denen man in Berührung kommt, auch auf ein Kind aus. Aber ich habe schon mehrmals gesagt, dass ich mit von der Partie war und dass ich eigentlich fast genauso wusste wie meine Eltern, was zu der Zeit gespielt wird. Und man hat sich geängstigt, dass das, was in Deutschland passiert war, auch in Österreich passieren könnte. Und es war gewissermaßen dieser Februar [19]34 im Karl-Marx-Hof und vielleicht auch in den anderen Gemeindebauten – nicht in den Nobelbezirken, die sind ja nicht beschossen worden – ein wesentlicher Einschnitt im Leben der Menschen und der ganzen Nation letzten Endes.
2/00:28:05
PR: Deine Familie und du, ihr habt euch dann in einem Polizeikommissariat melden müssen, wie du vorhin schon beschrieben hast. Aus welchem Grund habt ihr das tun müssen?
GC: Das mussten alle. Ich glaube, es war so, dass die Polizei den Hausmeistern die Anweisung gegeben hat…sie haben die Leute von ihren drei oder vier Häusern, die sie zu betreuen haben, zu sagen, dass sie sich da und dort versammeln müssten. Die müssten dann en bloc da hinübergehen und ihre Personalien und so weiter…und wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr, aber es kann sein, dass…es könnte sein, dass die Leute, wenn sie Waffen hatten, dass sie die Waffen abgeben mussten, aber das kann ich wirklich nicht sagen. Ich weiß ganz bestimmt, dass mein Vater keine Waffe hatte, aber es könnte sein, ich weiß es nicht. Und es war eine ganz…ich meine, es war nichts irgendwie Gefährliches oder es war nicht eine Zwangsmaßnahme und man wurde nicht geknüppelt oder sonst was. Es war eine Amtshandlung österreichischer Art. Und die Polizisten, die da waren, die waren so wie österreichische Polizisten damals waren: nämlich unfreundlich. Und man wurde natürlich angeschnauzt für jede Kleinigkeit: „Da dürfen Sie nicht hinein und da müssen Sie hin und unterschreiben Sie das!“ Das war der Kommandoton, aber sonst…es war wirklich…und dann wie man durchgeschleust worden war, konnte man wieder zurück in die Wohnung. Ich glaube auch…ich weiß es nicht mehr…das weiß ich wirklich nicht mehr, ob man die Türen offen lassen musste…ob die Wohnungen durchsucht wurden. Ich glaube, dazu hätte ihnen auch das Personal gefehlt, denn ich nehme an, wir waren innerhalb von einer Stunde, höchstens, wieder zurück in der Wohnung.
PR: Und in diesem Polizeikommissariat waren Leichenberge aufgebahrt von Leuten, die--
GC: --ja, es war so…das Kommissariat war…also ich wusste es damals bestimmt nicht, dass dort überhaupt ein Kommissariat war, aber…und vielleicht war es auch eine Behelfsbude, aber ich glaube es nicht. Aber das Kommissariat war in dem Gebäude von der Bahn…nicht von der Stadtbahn…also in dem Stationsgebäude von der Bahn und da ging dann…man musste in das Amtszimmer hinein und dort wurden dann die Personalien aufgenommen und dann ging es quasi durch eine Hintertür, durch einen Hinterhof innerhalb des Stationsgebäudes und dort, hinter einer Türe, lagen vielleicht sechs, acht, zehn Leichen und…einfach aufgestapelt. Und ich kann mich erinnern, dass…glaube mich erinnern zu können, dass meine Mutter oder mein Vater sagte: „Dreh dich nicht um!“ Und was wird ein Kind machen…und ich habe mich umgedreht und da sagte er oder sie zu mir: „Das sind die Leute, die erschossen worden sind.“
2/00:33:08
Und ich hatte zu der Zeit eben…zwischen der Machtergreifung und dem Februar [19]34 war ein Jahr…und zu der Zeit waren schon Leute aus Deutschland gekommen und die hatten, was damals genannt wurde braune Bücher…Braunbücher, so wie Weißbücher…die hatten solche Bücher mitgebracht. Und da waren Fotos von misshandelten Gefangenen drinnen. Und diese Fotos, die ich wahrscheinlich besser auch nicht hätte sehen sollen, habe ich damals auch schon gesehen. Leute, die am Rücken Striemen hatten oder ganz verquollene Gesichter und Derartiges. Also, dass diese Toten dort…später ging man im Karl-Marx-Hof selber, auch wenn man dann raus durfte…man durfte am zweiten Tag, bevor dieses Nachmittagsbombardement anfing, durfte man zwei Stunden hinaus, um Einkäufe zu machen, Lebensmittel. Und da war es so, dass man an Stellen vorbeikam, wo entweder die Roten oder die Schwarzen mit Kreide auf dem Gehweg eingezeichnet hatten, wo Leichen gelegen waren und das konnte man auch sehen.
PR: Weil du vorhin erwähnt hast und jetzt auch wieder, dass ihr Besucher aus Deutschland gehabt hattet, die Braunbücher gehabt haben: wie sind diese Besucher – das waren politische Flüchtlinge, nehme ich mal an – zu euch gelangt?
GC: Ja, das war wahrscheinlich so…oder nicht wahrscheinlich: das war so, dass da eben ein Netz war von, ich würde sagen, Gleichgesinnten. Und es waren dann auch schon Deutsche da, sozusagen Emigranten, nicht Juden, aber Emigranten, deutsche Sozialdemokraten, die dann Bekannte in Wien hatten, die wiederum mit uns bekannt waren. Und wo dann diese Leute hin- und hergereicht wurden, weil man auch wollte, dass das bekannt wird, was da in Deutschland passiert. Und es war nicht so, dass wir da eine…meine Eltern dann selber ein Spinnennetz gehabt haben, dass wir selber so operiert haben. Es war dann auch so, dass die…wir hatten zum Beispiel in der Zeit vor [19]34…waren Besucher bei uns, die von den Quäkern geschickt worden sind, weil der Karl-Marx-Hof ein Vorzeigeobjekt war. Und weil es wirklich…man hat dann in England den Ausdruck geprägt: intentional communities. Also eine planwirtschaftliche…eine geplante Gemeinschaft. Und man hat das wirklich als etwas Richtungweisendes betrachtet. Und einmal ist sogar der spätere Eduard VIII. in den Karl-Marx-Hof gekommen und ist herumgeführt worden – und ist trotzdem ein Nazi geworden.
2/00:38:16
Da sind immer Leute gekommen, die wir herumgeführt haben – also ich nicht, aber meine Eltern. Und auf diese Weise…und ich weiß auch warum: weil beide Eltern einigermaßen Englisch konnten. So hat sich dann durch irgendwelche Bekanntschaften herumgesprochen, wenn da drei Lehrerinnen aus Nottingham nach Wien kommen, dann schickt man sie zu den Czuczkas in den Karl-Marx-Hof, die führen sie da rum und dann samma [sind wir] sie an [einen] Nachmittag los. So muss es ja nicht gewesen sein, aber jedenfalls so war es. Und die kamen dann in unser Haus und waren sehr nett und meine Eltern haben dann mit denen noch jahrelang korrespondiert, auch wie wir dann schon in Amerika waren. Ja, ich meine, auf diese Weise sind dann auch solche Leute aus Deutschland zu uns gelangt. Durch…ich weiß nicht…mein Vater hat zum Beispiel Artikel geschrieben für eine Zeitschrift, die ich eigentlich nie zu Augen bekommen habe, die hieß Die Unzufriedene. Das war offenbar eine Zeitschrift von der SPÖ [Sozialistische Partei Österreichs] damals in den [19]20er- und frühen [19]30er-Jahren für Frauen. Und er hat in dieser Zeitschrift Tipps gegeben für Wohnungseinrichtung und wie macht der gute Sozialdemokrat oder die gute Sozialdemokratin ihre Küche am besten. Dass er zum Beispiel durch diese Beziehungen…meine Tante war eine Sekretärin von Oskar Pollak, zum Beispiel, und die war immer in der Partei irgendwie mit von der Partie. Wo ich hingeschaut habe, waren solche Leute und es war wirklich ein großes Netz, aber es war nicht ein Nest von, sagen wir, Aktivisten, die auf die Barrikaden gehen würden, sondern das waren so Intellektuelle, Bildungsbürger und kleinere professionals, die eben mitgemischt haben.
2/00:41:39
PR: Was da in deinen Ausführungen vorher meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, das war unter anderem auch die Geschichte von diesem ehemaligen SA‘ler, der nach dem Röhm-Putsch nach Wien gekommen ist. Was hat es mit dem auf sich gehabt? Mal abgesehen davon, dass er euch die Warnung gegeben hat, was geschehen wird nach dem Anschluss – kannst du mir über den ein bisschen mehr erzählen? Weil der ist ja ein bisschen beim Beschriebenen aus der Rolle gefallen, ein ehemaliger SA‘ler, der--
GC: --es war so, mein Vater hat…so kam man zu manchen Leuten eben, weil eine Frau aus dem…ich glaube, sie war aus dem Saarland. Vielleicht war er auch aus dem Saarland, jedenfalls, es…mein Vater hat einen…war in der Hauptsache Innenarchitekt…wenn er seinen Beruf ausüben konnte, dann war er Innenarchitekt und war sogar ein recht guter Innenarchitekt. Und hat einen Auftrag bekommen von einer Frau, die anscheinend…vielleicht war sie geschieden und die ist mit ihren Kindern nach Wien, sagen wir jetzt mal aus dem Saargebiet…Saarland…wie die Nazis kamen. Das muss also 1935 gewesen sein. Da ist das Saarland zurück ins Reich gekommen. Und [19]34 war dort ein Putsch, glaube ich. Und er hat einen Auftrag bekommen, bei ihr die Wohnung einzurichten, was damals hieß, nicht zu einem Möbelgeschäft zu gehen, sondern Möbel machen zu lassen. Und die hatte offenbar genug Geld, um sich das leisten zu können und war aber trotzdem eine ganz solide Sozialistin oder Sozialdemokratin. Und die muss nun eben diesen Mann irgendwoher gekannt haben, diesen SA-Menschen…ich habe keine Ahnung, wie sie zu dem gekommen ist. Und jedenfalls, ich war ab und zu mit meinem Vater bei dieser Frau, weil…ich weiß nicht warum, einfach so. Und die muss höchstwahrscheinlich den an uns…meine Eltern weiterverwiesen haben. Und dann kam er auch ins Haus, ab und zu, und war ein irgendwo schneidiger, wenn auch schwuler Mann und hat dann ausgepackt über die Sachen.
2/00:45:26
Und es war ja so bei der SA…die SA war ja nicht eine Nazitruppe an sich, die SA war eine…war insbesondere nach der Machtergreifung…ich glaube, er war schon vorher dabei…aber nach der Machtergreifung waren es ja enttäuschte Kommunisten, die zur SA gegangen sind und die die Nazis auch gerne aufgenommen haben und als Kanonenfutter oder Schlägertrupp benützt haben. Und es kann sehr wohl sein, dass auch er gar kein so überzeugter Nazi war. Er kann auch einer von den Gregor Strasser-Leuten gewesen sein. Auf jeden Fall, er war…er schien vertrauenswürdig. Ob er es wirklich war: who knows. Er kann genauso gut auch ein Agent gewesen sein, der im Jahre [19]35 oder [19]36 unter falschen Flaggen nach Österreich eingeschleust worden ist. Auf jeden Fall, er hat aber…ich meine, warum sollte er meinen Eltern sagen: „Wenn die Nazis kommen, ergreift die Flucht.“? So lieb waren sie nicht zu ihm und er selbst war bestimmt kein Jude. Und ich weiß nicht…ich glaube, es war einfach so eine Zufallsbekanntschaft, eine von vielen, und es war an sich…der beste Freund meines Vaters war ein Wiener, der Schauspieler wurde und dann nach Deutschland ging und…in was heute Baden-Württemberg ist. Und hat dort an einem Theater in Stuttgart gespielt…Heidelberg, ich weiß nicht. War ein sehr lieber Kerl und mein Vater war mit ihm ins Gymnasium gegangen und er hatte keinen…ich glaube, seine Mutter war eine Witwe und meine Großmutter war eine Witwe und da haben die…nicht Babysitting, aber so was Ähnliches gemacht. Und der hatte dann in Deutschland eine deutsche Jüdin geheiratet, die hatten zwei Töchter und lebten in Heidelberg und der kam dann auch zu uns, weil…nein, der kam immer wieder nach Wien, wahrscheinlich, um seine Mutter zu besuchen oder seine Verwandten. Und der hat dann auch erzählt, wie das ist bei den Nazis. Und er war natürlich angekränkelt dadurch, dass er die Jüdin geheiratet hat und…was ihn nicht davon abgehalten hat, sich scheiden zu lassen. Sie ging dann nach England, die beiden Töchter gingen nach Belgien und eine davon hat es, glaube ich, überlebt und die andere nicht. Und er war absolut gegen die Nazis und hat dann, wie gesagt, erzählt, wie das ist und wie schlimm es für die Juden ist und für die Frau und wie schwierig es war für ihn in die Reichstheaterkammer aufgenommen zu werden und so weiter. Herr Gründgens und…was weiß denn ich.
2/00:50:08
Wie gesagt, er kam dann nach Wien, das war…[19]36 oder [19]37 muss es gewesen sein, wie der Olympia-Film herauskam. Und ich sagte zu ihm: „Du Richard, ich möchte gerne den Olympia Film sehen und ich kann nicht, denn als Jude darf ich gar nicht mehr ins Kino!“ Nein, das muss ja später gewesen sein. Also, es war jedenfalls schon zur Nazizeit in Wien. Da haben sie dann den Olympia-Film im UFA-Palast auf der Taborstraße, glaube ich, gespielt und er hat gesagt: „Komm mit mir.“ Und er ist mit mir dorthin gegangen. Und diese Idioten sind…vor dem Film wurde tatsächlich das Horst-Wessel-Lied und das Deutschlandlied, glaube ich, gespielt. Und da standen alle im Publikum auf und machten diesen. [Zeigt wohl den Hitlergruß.] Und wir standen mit auf, aber machten ihn nicht. Es hat uns Gott sei Dank in dem Halbdunkel niemand bemerkt. Und dann haben wir uns den Olympia-Film zusammen angesehen. Das konnte man damals halt noch. Und es war auch in der Schule so…wir waren wiederum fünf Juden in der Klasse von 30 vielleicht. Und es fing ja dann gleich an, wenn der Unterricht begann, der Klassenlehrer kam: „Heil Hitler!“ Und ich hatte einen Mitschüler, der hieß Eisinger, der war ein bisschen nervös. Und wie alle aufgestanden sind und „Heil Hitler“…wir haben uns in die letzte Bank verfrachtet. Und wie alle aufstanden…wir sind alle aufgestanden…wie alle aufgestanden sind und die anderen haben „Heil Hitler“ gemacht, da hat er auch „Heil Hitler“ gemacht und ich sagte dann: „Schurl, des [das] kannst [kannst du] ja ned [nicht] machen!“
Über den SA-Mann, wie gesagt, kann ich nicht sehr viel sagen.
PR: Wie ist denn der Eindruck entstanden, dass er sexuell anders orientiert ist?
GC: Das habe ich an mir selbst erlebt…ja, das war nicht angenehm.
Ende von Teil 2
Teil 3
PR: Die Eltern von dir sind ja in den Untergrund gegangen--
GC: --ja, Untergrund, ich meine, sie haben mitgeholfen in der Bewegung, die da existierte und was da…also meine Mutter in der Hauptsache hat es so gemacht, wie ich sagte…sie wurde dann durch diese Beziehung zu den Quakers gefragt, ob sie im Karl-Marx-Hof für diese…entweder die, die tatsächlich umgekommen waren beim Beschuss oder aber die ins KZ in Wöllersdorf gekommen waren…ob sie das übernehmen könnte für diesen Teil des Karl-Marx-Hofes. Und es ging auch eigentlich weiter, nicht nur im Karl-Marx-Hof. Ich kann mich erinnern, ich bin manchmal oder relativ oft sogar mit ihr mitgegangen und sie hatte da so eine Art…wie soll ich das nennen, ein Kassenbuch oder was, wo…und sie hatte das Geld von den Quakers und man ging dann zu diesen…meistens waren es natürlich Frauen, Mütter oder Ehefrauen von diesen Kämpfern, die…und ging dann dorthin und brachte denen eine geringfügige Unterstützung. Ich glaube, zehn Schilling im Monat, in der Woche, ich weiß nicht. Und die mussten wiederum…damit alles mit rechten Dingen zugeht…mussten unterschreiben und meine Mutter musste dann die unterschriebenen Belege bei den Quakers abgeben und verrechnen. Und manche von ihnen konnten nicht schreiben…wirklich, ich kann mich an eine erinnern, die war eine…Tschechin und die konnte nicht schreiben. Die hat richtig drei Kreuzerln gemacht…oder ein Kreuz. Hier macht man drei Kreuzerln.
Und dann lernten wir zum Beispiel diesen Mr. Brunswick kennen. Und der Mr. Brunswick war ein Komponist und seine Frau war eine Freudschülerin. Und die wohnten in Döbling in einer Villa mit ihrer Tochter, hatten ein großes Auto in Wien und sagten: „Wie können wir helfen?“, zu den Quakers. Und die sagten: „Anyway you like!“ Und die sagten: „Wir haben da Kleider und Spielsachen von unserer Tochter.“ Da sagten die zum Beispiel: „Wir schicken unseren Chauffeur und der bringt ihnen ein paar Kartons mit…Anziehsachen, Krawatten.“ Und eines Tages kamen einige Paar Schuhe und da waren die Absätze etwas abgelaufen und meine Mutter ging dann einmal zu ihm hin und sagte: „Mr. Brunswick, Sie haben da Schuhe anscheinend fälschlich mitgeschickt…da waren ja nur die Absätze abgelaufen.“ Sagt er: „Solche Schuhe trägt man nicht mehr.“ [Lacht.] Und wir haben das dann vielleicht zum Schuster gegeben oder vielleicht nicht und haben sie dann den Leuten gebracht und die sind dann mit abgelaufenen Absätzen weitergegangen. Und solche Leute gab es dann, die solche Sachen gespendet haben, manchmal auch Lebensmittel. Aber in der Hauptsache war es Geld, weil sie ja schließlich, ich weiß nicht…nein gar nicht, die Leute mussten ja weiter, zum Beispiel, Zins zahlen und das Geld mussten sie ja haben, damit sie ihnen über die Runden helfen konnte. Und die Mutter hat in der Hauptsache das gemacht. Der Vater hatte einen Verwandten, der eben mehr aktiv war und der auch richtiggehend Artikel geschrieben hat für Zeitungen und Flugblätter. Und die haben dann…und er hat dann eher sich um den, wie ich schon sagte, Vertrieb oder Verteiler gekümmert. Und manchmal bin auch ich eingespannt worden und habe das eben gemacht…dass ich die Sachen rumgetragen habe, weil es auch unverfänglicher war.
3/00:06:39
Später, wie die Nazis wirklich kamen…meine Eltern hatten eine verhältnismäßig große Bibliothek mit lauter…mit nur falschen Büchern. Und der Vater hat die Weltbühne abonniert – auch noch wie sie, glaube ich…in Prag gemacht wurde oder in Paris. Auf jeden Fall, er hatte sie noch bis zur Nazizeit, bis zum Anschluss…hatte er sie bei uns. Und dann in der Nacht nach dem Einmarsch hat er…oder haben wir zusammen, alle drei, die Weltbühnen, die sich da angesammelt hatten – Jahrgänge – zerfetzt. Es war Gott sei Dank nicht so warm…und haben die Öfen angeheizt und haben es zu verbrennen begonnen. Und es ging aber nicht schnell genug und jetzt haben wir es noch kleiner zerfetzt und ins Klo geworfen. Und am Tag danach kam der Hausmeister und sagte: „Herr Czuczka, haben sie die Weltbühne abonniert?“ Sagte mein Vater: „Ja.“ Da sagte er: „Sie haben einen Rohrbruch verursacht!“ Und da war unten im Keller das Rohr vom Klo…und nicht nur von unserem…und das war geborsten, weil wir so viel Papier…es war verstopft und es war geborsten…und der hat meinen Vater offenbar nicht verpfiffen, aber das war so ein kleines Intermezzo von vielen.
Und dann haben die…ihre Bücher haben sie zum Teil anderen Genossen gegeben, die sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge übernommen haben. Und einige haben sie dann irgendwie weitergeschmuggelt und dann haben wir sie noch nach Amerika mitgenommen. Wir konnten schon noch ein paar Kisten nach Amerika mitnehmen. An sich hatten wir nicht mehr sehr viel, aber das…ein paar Sachen hat er aufgehoben. Er war in der Kunstgewerbeschule gewesen und hat eigene Zeichnungen mitgenommen.
PR: Die Flugblätter, über die du vorhin gesprochen hast, die du hin und wieder auch geholfen hast mit zu verteilen, das waren Flugblätter, die von der Sozialdemokratie gekommen sind?
GC: Ja. Es war dann so, ich glaube, dass die Eltern an der Sozialdemokratie…also, ich würde sagen, eher mein Vater als meine Mutter…oder nicht, ich weiß nicht…dass sie an der Sozialdemokratie irgendwo verzweifelt sind. Und die sind dann in dieser Zeit zwischen [19]34 und [19]38 ein bisschen abgedriftet. Sie sind nie richtige Kommunisten geworden, aber sie haben, sagen wir mal, wenn es das gegeben hätte als Bezeichnung, politische Richtung…sie wären halt Linkssozialisten gewesen. Und wenn sie hätten wählen können, hätten sie wahrscheinlich, heutzutage oder damals, wie die Kommunisten nach Ostdeutschland gekommen sind, die SED [Sozialistische Einheitspartei Deutschlands] gewählt. Sie wären wahrscheinlich an der auch wieder verzweifelt, weil das ja doch nicht so war, wie es geplant hätte sein können. Aber in dieser politischen Richtung wären sie gewesen und waren sie auch und waren es auch hier. Insofern sie es eben nicht waren, weil der Roosevelt ein solches Leitbild war für eine Sozialdemokratie so wie sie sein sollte. Es gibt heute noch Wiener Juden, die richtige Republikaner sind und die sagen: „Über den Roosevelt dürfen Sie nichts Schlimmes sagen, der…das war ein Gentleman und der hat gewusst, wie man das macht!“ Aber inzwischen sind sie ganz weit hinüber nach rechts gedriftet.
[Übergang/Schnitt.]
3/00:13:00
PR: Die Materialien, die deine Eltern mit deiner Hilfe verteilt haben…oder dein Vater…weißt du von welcher Gruppierung diese Flugblätter waren?
GC: Ich wollte, ich könnte das genau sagen. Ich glaube mich nur an etwas zu erinnern, das Rote Fahne geheißen hat. Und das klingt mir sehr kommunistisch aber dann wird es das halt gewesen sein. Aber an anderes kann ich mich wirklich nicht erinnern. Also, es kann schon sein, dass er soweit hinübergedriftet ist, dass er das verteilt. Geholfen hat es ja auch nichts. [Lacht.]
PR: Eine weitere Nachfrage, mit der ich jetzt an dich herantreten muss, ist die ganze Geschichte mit eurem Affidavit. Du hast das kurz umrissen gehabt. Kannst du vielleicht noch einmal zusammenfassen, wie ihr an dieses Affidavit herangekommen seid und über welche Kanäle das gespielt worden ist?
GC: Das ist der gleiche Mann, der dieses…Hilfsprogramm für die Februargeschädigten mitunterstützt hat. Wir waren mit ihm eigentlich…wenn ich wir sage, spreche ich immer von meinen Eltern zu der Zeit natürlich. Meine Eltern waren mit ihm eigentlich laufend in Kontakt. Ich habe ihn nie in unserem Haus gesehen und ich glaube auch nicht, dass wir bei ihm…dass sie, meine Eltern, bei ihm oft eingeladen waren, aber sie haben miteinander…sie waren gleichgesinnt und haben helfen wollen. Und er war…der Brunswick selber war derjenige, an den sich mein Vater praktisch sofort nach dem Anschluss gewendet hat. Und es war so, dass er, ohne zu zögern, uns ein fixes und fertiges Affidavit geschickt hat. Und mein Vater ging dann…wir hatten uns schon beim Amerikanischen Konsulat registrieren lassen, um auf die Einwanderungsquote zu kommen. Und wie er das Affidavit hatte, ging mein Vater dahin und sagte: „Ich habe da das Affidavit. Wie lang wird es dauern, bis wir unser Visum bekommen?“ Und die haben das Affidavit überprüft und zu meinem Vater gesagt, ich glaube, einen Monat oder irgendwas, was ja damals eben länger gedauert hat. Und wir mussten ja auch sehen, ob der Mann wirklich so viel Geld hatte, dass er jemanden sponsern konnte. Und vielleicht lagen auch Affidavits für andere Leute von diesem guten, wohltätigen Menschen schon im Konsulat, vielleicht war er im Konsulat schon bekannt. Wahrscheinlich war er es.
3/00:17:25
Es war dann so, dass mein Vater, wahrscheinlich oder bestimmt, glücksstrahlend nach Hause gekommen ist und gesagt hat: „Wir haben es und wir sind bald von hier weg.“ Und das Ganze fiel dann ins Wasser, weil der Vater Ende Mai verhaftet wurde und danach mussten…wir hatten das Visum sicher, es war gar keine Frage. Und das war nicht unsere Sorge. Die Sorge war der Vater und die Sorge war die Beschaffung von den verschiedenen anderen Papieren, die eben nötig waren. Und dann hatten wir obendrein auch Geldsorgen, für die Schiffspassage und Steuern, Unbedenklichkeitserklärung und so weiter. Aber es war eine fertige…wie man in Wien sagt: „A gmahde Wiesn“ [„Eine gemähte Wiese“, ugs., meint: eine Sache, die leicht zu bekommen oder zu erreichen ist].
PR: Du hast ja von der Verhaftung deines Vaters berichtet. Kannst du dich an den Tag erinnern, kannst du dich an die Verhaftung erinnern? Warst du dabei?
GC: Sicher. Meine Mutter war aus irgendeinem Grund nicht zuhause. Es war ein sehr schöner Frühsommernachmittag und ich war alleine mit meinem Vater zuhause und es hat geklingelt und unser freundlicher…Kriminalkommissar stand vor der Tür und sagte zu mir…ich habe die Tür aufgemacht…und er sagte zu mir: „Ist dein Vater zuhause?“ Und ich sagte „Ja.“ Und da sagte er: „Sag ihm, er soll kommen.“ Und mein Vater war schon auf dem Weg und sagte: „Ja, bitte?“ Und er hat gesagt: „Herr Czuczka, Sie sind verhaftet.“ Mein Vater war natürlich völlig verdattert, ich meine, er hat…ob er es erwartet hatte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, er war verhaftet und er fragte den Kommissar, den wir schon von vorher kannten, denn er war schon gekommen noch vor dem Anschluss und er hat uns gesagt: „Sehen Sie sich vor! Machen Sie das ned [nicht]!“ Es war nicht eine Freundschaft, aber es war wenigstens ein Mensch, mit dem man halbwegs reden konnte. Und er hat ihn gefragt: „Soll ich meinen Mantel mitnehmen?“ Es war sehr warm draußen und da hat er gesagt: „Ja, nehmen Sie den Mantel ruhig mit.“ Und er hat den Mantel, einen nicht sehr dicken Mantel, über den Arm genommen und dann hat der Kommissar gesagt: „Das Zahnbürstel [Zahnbürste] könnten Sie auch mitnehmen und a bissl [ein bisschen] Geld.“
3/00:21:37
Und dann sind die beiden weggegangen. Und das nächste Mal, dass wir vom Vater gehört hatten, war, dass er in dem Sammellager war in Wien, im 20. Bezirk in der Karajangasse. Und da konnte er einen kurzen Brief schreiben. Und dann…hörten wir erst wieder von ihm wahrscheinlich zwei, drei Wochen später, vielleicht sogar einen Monat, aus Dachau. Dann hat er von Dachau…ich weiß nicht, ob es alle vierzehn Tage war oder alle Monate…und dann waren auch manchmal Sperren, wo er nicht schreiben konnte. Und wir konnten ihm schreiben und wir konnten ihm auch, wenn ich mich nicht sehr irre, Geld schicken, sonst nix [nichts]. Und er hat auf der Fahrt nach Dachau, auf dem Zug…das hat er uns später erzählt…auf der Bahn hatten sie…wurden sie – das wirst du schon von anderen gehört haben – in Wagenabteile gepfercht, zu acht oder zu zehnt und mussten ganz eng gedrängt dasitzen. Und dann haben sie die Heizung angestellt und haben die Wagen beheizt obwohl draußen Frühlingswetter war. Und sie mussten dann auf der Fahrt…einerseits mussten sie Lieder singen, teilweise jüdische Lieder, hebräische Lieder und dann mussten sie Turnübungen machen auf engstem Raum. Und das waren verschieden alte Leute und manche sind mitgekommen und manche nicht. Manche sind praktisch ohnmächtig geworden. Mein Vater war an und für sich ein nicht sehr großer Mensch, er war so 1,70 Meter vielleicht 1,75 Meter. Und neben ihm saß ein anderer, der, ich glaube, 1,80 Meter, 1,85 Meter war. Und der SS-Mann, der an der Eingangstür zu den Abteilen gestanden hat, hat gesehen, wie der eingenickt ist und hat seinen Säbel gezogen und hat in das Abteil…ist halb in das Abteil hineingegangen und hat mit dem Säbel…[macht ein entsprechendes Geräusch] gemacht und hat diesem Mann auf der Brust treffen wollen oder hat ihn getroffen. Meinen Vater hat er hier getroffen--
PR: --unter der Nase.
GC: --unter der Nase. Und er hat geblutet wie ein Schwein auf dem Transport und ist dann…natürlich, das ist verkrustet. Und irgendwie hat er keine Blutvergiftung und gar nichts bekommen und es ist verheilt. Und er hat dann eine Art Hasenscharte gehabt, aber es war waagrecht und nicht senkrecht…aber das hat er gleich zu Beginn seiner Karriere als Strafhäftling bekommen.
3/00:26:14
Später hat er sogar eine ganze Aufzeichnung gemacht über Dachau und Buchenwald. Und auch über die Fahrt und hatte gesagt, dass die Polizei, die sie bis zum Westbahnhof, sagen wir, begleitet hat…dass die Polizei sich absolut menschlich und korrekt verhalten hat. Und, dass sie von dann an der SS überantwortet worden sind und, dass sie Spießrutenlaufen mussten und dass sie jämmerlich ge- und zerschlagen worden sind. Und vielleicht…glaube ich mich auch zu erinnern, dass einige, die versucht haben wegzulaufen, dort an Ort und Stelle erschossen worden sind. Er hatte im Krieg [meint: Erster Weltkrieg] schon eine ganze Menge miterlebt und, wie gesagt, ich habe sehr wohl gewusst, was er da erlebt hatte und er hat sich auch deshalb große Sorgen gemacht trotzdem er dafür war, dass ich in die Armee gehen würde und auch dafür war, dass ich in den Kampf gehen sollte…es hat ihm sehr weh getan. Er hat immer wieder gesagt: „Hoffentlich musst du das nicht erleben, was ich erlebt habe im Krieg!“ Er war absolut ein…sagen wir, ein Pazifist. Das war ja auch wahrscheinlich ein Jammer von diesen ganzen Leuten, die im Krieg waren, die das irgendwie seelisch mitgekriegt haben, dass sie Pazifisten waren und dass sie nicht bereit waren zu kämpfen.
PR: Deine Mutter und du, ihr habt ja dann ausziehen müssen aus der Wohnung im Karl-Marx-Hof als dein Vater schon interniert war. Kannst du dich erinnern, was die Reaktionen von den Nachbarn waren? Hat es irgendwelche Reaktionen von den Nachbarn auf euren Auszug gegeben oder generell von Leuten aus eurem Umfeld?
GC: Eigentlich nicht. Ich kann mich schon daran erinnern, dass wir ausgezogen sind und es passierte praktisch sofort danach, nachdem mein Vater verhaftet wurde. Ich kann mich nicht erinnern…ich glaube, dass…an was ich mich zu erinnern glaube ist, dass manche Leute sich einfach abgewendet haben von uns, sofern wir überhaupt mit ihnen engeren Kontakt hatten. Ich meine, es ist ein Wohnsilo, dieser Karl-Marx-Hof. Wir haben auf einer Stiege gewohnt und man hat in den meisten Fällen die Leute auf der anderen Stiege kaum gekannt. Und die Leute auf unserer Stiege…haben wir…einen Großteil davon gekannt. Und manche von den anderen Leuten hatten Kinder, die mit mir in die Volksschule gegangen sind. Und die kannte man auch. Und dann kannte man Leute von ganz wo anders im Karl-Marx-Hof. Aber ich glaube, manche Leute haben gesagt: „Das ist ja schade und Sie müssen gehen. Wo gehen sie denn hin? Wie geht es Ihrem Mann?“ Aber man ist ja als Großstädter trotz allem nicht so eng mit seinen Nachbarn verbunden. Man ist mit den Leuten, mit denen man wirklich was zu sagen und zu reden hat…und die so denken wie man selbst…mit denen oder mit der Familie. Und die Familie hat nicht im Karl-Marx-Hof gewohnt. Wir haben mit der Familie die ganze Zeit Anschluss gehabt und die sind auch zum Beispiel dorthin gekommen, wo wir in der Villa gewohnt haben, meine Mutter und ich. Und wir haben sie besucht. Aber dort, ich glaube nicht, dass man…der Hausmeister hat sich richtiggehend verabschiedet. Der war ein braver Genosse und der hat es gemacht. Aber ich glaube nicht sonst. Oder es sind…natürlich sind die Leute, denen wir nahestanden, die nicht im Karl-Marx-Hof gewohnt haben, sondern in der näheren Umgebung, die sind die ganze Zeit gekommen. Die haben auch unter Umständen vielleicht geholfen beim Umzug, aber die Nachbarn selber nicht unbedingt.
3/00:32:36
PR: Du hast erwähnt, dass ihr nach…auf dem Weg eurer Emigration, als der Vater dann schon wieder zurück war, über Zürich nach Paris gegangen seid und dann mit dem Schiff nach Amerika gekommen seid. Kannst du mir nur sagen, wann ihr von Wien weggegangen seid? Wie lange ihr in Zürich wart--
GC: --jeweils eine Woche in Zürich und in Paris. Die Schweizer und die Franzosen haben damals, jedenfalls uns, nur ein ganz begrenztes Visum gegeben. Die Schweizer zumal und die Franzosen haben ein Durchreisevisum mit einwöchigem Aufenthalt…weil das Schiff aus Cherbourg abgegangen ist. Und wir hatten in Zürich…in Luzern hatten wir Verwandte schon seit eh und je. Und in Zürich hatten wir Bekannte, sehr gute Bekannte, die uns aufgenommen haben für diese Woche. Und in Paris hatten wir einen Bruder meiner Mutter, der…dessen Geschichte allein ein…ich sollte einmal einen Roman über den schreiben. Ich erzähle es dir nur so nebenbei. Der war der einzige Bruder meiner Mutter. Meine Mutter hatte acht Schwestern und einen Bruder, er war der Jüngste. Und er ist von zuhause weg nach Deutschland und dann in Deutschland eine längere Zeit gelebt. Hat als Österreicher sogar nach der Machtergreifung in Deutschland gelebt. Und hat dann eine arisch…arischer geht es überhaupt nicht…eine strohblonde, blauäugige Schönheit gefunden, aus Danzig, und ist mit der…hat mit der in Berlin gelebt. Und hat irgendwelche, teils sogar windige Geschäfte gemacht und war überhaupt, mehr oder weniger ein Hallodri. Aber mein…ich hatte nur den einen Onkel auf der Seite…aber er war praktisch mein Lieblingsonkel. Und der war in Deutschland und dann hat er gefunden, er muss nicht unbedingt unter den Nazis leben und ist nach Wien zurückgegangen. Und hat dann in Wien weiter so gewerkelt und hat seine Schönheit mitgebracht. Sie war fast so etwas wie ein fashion model und war eine sehr liebe Frau. Und dann, wie der Anschluss kam…nein, er hat die Lunte gerochen und ist vorher gegangen und ist nach Paris gegangen. Und hat in Paris gelebt und wieder solche Geschäfte gemacht, die…sie waren nicht wirklich unlauter, sie waren irgendwie…er hat immer eine Nische gefunden für seine Geschäfte und ist dann in Paris gewesen, wie wir da durchgekommen sind. Und dann kamen die Deutschen nach Frankreich.
3/00:37:04
Er wurde interniert und ist ihnen dann, glaube ich, ausgebüchst mit seiner Freundin, die er noch immer nicht geheiratet hatte. Und ist nach Vichy France gegangen und hat sich in Lyon niedergelassen. Wir haben ihm von hier geschrieben: wir schauen, ob wir dich rauskriegen. Er hat gesagt, das möchte er auch. Und es funktionierte dann doch nicht und wir verloren ihn aus den Augen. Der Krieg war vorbei und wer als einer der Ersten auftauchte, war mein lieber Onkel. Weil er war in Lyon gewesen mit seiner Freundin, nicht verheiratet, mit falschen Papieren und hatte mit einem Franzosen in Lyon ein Lederwarengeschäft aufgemacht. Und hat den ganzen Krieg überdauert und ist dann wieder nach Paris zurückgegangen. Hat in Paris eine Ledermodewarenmanufaktur aufgemacht und ist fast ein Millionär geworden. Und hat dann im reifen Alter von 81, nachdem die Frau leider gestorben war…ist er nach Wien zurück und hat dabei auch schon wieder ein vollkommen verrücktes Erlebnis gehabt. Er ist…zuerst hat er in dem Heinrichshof gewohnt bei der Oper. Und dort hat es ihm eigentlich doch nicht gefallen und er ist zurück nach Mariahilf, wo er auch geboren war. Und hat sich dann eine…Eigentumswohnung dort gekauft in einem Altbau und hat die Wohnung besichtigt, hat gesagt: „Ja, das ist gut, der Preis stimmt, ich kaufe das.“ Und ging dann…zog dann ein und die Spediteure brachten dann seine Sachen dorthin und gingen ums Eck mit seinen Sachen und er sagte: „Kommt zurück, da ist der Eingang!“ Und die sagten: „Nein, nein, da ist…da muss man mit den schweren Sachen rein!“ Und er ging ihnen nach und stellte fest, dass er in das Haus seiner Eltern gezogen ist. Nämlich, das Haus hatte zwei Eingänge und er konnte sich als Kind nur…aus seinen Kindheitserinnerungen nur an den Eingang erinnern, wo er immer aus- und eingegangen war. Und wenn er den zweiten Eingang je gesehen hätte, dann hätte er sich: gesagt: „Ja, das ist ja der Eingang, wo wir immer rausgegangen sind, wo wir spielen gegangen sind.“ Und das war eine sehr hübsche und tolle Geschichte für ihn.
PR: Wie hat er geheißen?
GC: Er hat Felsenburg geheißen.
PR: Und mit Vornamen?
GC: Berni, Bernhard – warum?
PR: Warum? Weil wir die Geschichte jetzt…nicht, weil ich das Buch schreiben möchte--
GC: --ich habe mir gedacht, du würdest jetzt sagen: ich habe mit jemanden gesprochen--
PR: --nein, aber ganz einfach, weil wir die Geschichte jetzt aufgenommen haben und es auch gut ist zu wissen, wer das war. Auf jeden Fall, wann seid ihr aus Wien--
GC: --das wolltest du ja ursprünglich wissen. Das muss Ende März gewesen sein. Ja, genau, es war Ende März und wir sind am 16. April nach New York gekommen.
PR: Und wir reden jetzt über das Jahr 19--
GC: --[19]39.
3/00:42:19
PR: Hast du an diese absurde Schifffahrt mit den KdF-Urlaubern…kannst du dich daran erinnern wie das Schiff geheißen hat?
GC: Ja, kann ich sehr wohl, es hat Hansa geheißen…war Norddeutsche Lloyd oder Hapag. Das Schiff ist später im Indischen Ozean versenkt worden bei irgendeiner…sie haben, glaube ich, versucht es zurück nach Deutschland zu bringen und es war dann auch bewaffnet mit irgendwelchen Bordkanonen oder vielleicht auch nicht. Aber jedenfalls ist es im Indischen Ozean versenkt worden.
PR: Das heißt, ihr seid 1939 in den USA angekommen. Und wie euch dieser Mister Brunswick abgeholt hat, das hast du eh schon erwähnt. Wofür ich mich jetzt als nächstes interessiere, das ist das rote City College. Du hast ja kurz angemerkt, dass das als ein sozialistisches, kommunistisches College verschrien war. Kannst du dich an Aktivitäten dort erinnern? Und vor allem: wie ist deine eigene Geschichte dort weitergegangen?
GC: Überhaupt nicht, denn ich weiß nicht, wir…ich glaube, dass sich da auch ein Wandel vollzogen haben muss, wie wir nach Amerika gekommen sind. Und mit dem Stichwort Roosevelt ist praktisch alles erklärt, denn man kam aus dieser mitteleuropäischen…aus diesem mitteleuropäischen Hexenkessel heraus. Ich meine, Hexenkessel nicht nur wie man es normalerweise benützt, sondern wirklich, wo doch jeder seine eigene Suppe in diesem Kessel kochen wollte. Und es war immer irgendetwas los und immer Unruhe und immer Umsturz. Und die Idee, dass wirklich einmal…irgendwo anders zu wissen und zu wissen, da ist jetzt ein sehr großer Ozean zwischen mir und denen dort…sollen die sich die Schädel einschlagen. Hier, also hier in Amerika, herrscht ein ganz…da weht ein ganz anderer Wind und die Idee, dass du dieses amerikanische Füllhorn, das sich da ergießt über dich, ob du nun…und ich meine das gar nicht unbedingt von der Finanz her, sondern ideell, mental, seelisch. Und wenn du siehst, was für eine Rasse von unkomplizierten Menschen hier sind, unbelasteten…dann, glaube ich, schaltest du einfach ab und sagst so, wie jeder andere Immigrant in Amerika: „Das ist das – und das ist das andere. Und ich werde mein Möglichstes versuchen, jetzt auch ein Amerikaner zu werden!“ Und es ist sehr komisch, denn, wie ich dann im Ausländischen Dienst, im Foreign Service war und Amerika vertreten musste, sollte, durfte, haben mich manchmal schon geborene Amerikaner gefragt: „Wie fühlt sich das eigentlich an, ein Austro-American zu sein?“ Und ich sagte Ihnen: „I don't feel like an Austro-American, I feel like an American!” Und ich muss sagen, das ist auch, wie ich mich heute fühle. Natürlich spreche ich die Sprache weiter, natürlich lese ich auch die…manchmal den Standard, aber an sich…und ich lese auch deutsche Bücher und ich abonniere Die Zeit. Ich habe eben jetzt Die Zeit abbestellt, weil sie mir ein bisschen zu blöd geworden ist.
3/00:48:15
Aber abgesehen davon…ich glaube wirklich, das mit dem melting pot hat schon seine…ist schon wahr und es ist…im Guten und im Bösen ist es wahr und du wirst nivelliert auf der anderen Seite, wenn du dich lässt, und du wirst einbezogen auf der anderen Seite, wenn du dich lässt. Ich finde…und das hat, glaube ich…es ist ja alles so wie durch die Osmose passiert…das, was die Eltern fühlen, fühlen die Kinder wahrscheinlich auch mit. Und wenn die Eltern sich mehr oder weniger abwenden von einer aktivistischen Einstellung zu einer zufriedenen Einstellung mit den Dingen, wie sie sind, dann wird sich wahrscheinlich auch ein Kind damit abfinden. Und ich war noch ein Kind, wie ich hierhergekommen bin. Und so wird es wahrscheinlich gewesen sein. So, dass wenn der gute Vater Roosevelt für uns schaltet und waltet und uns unser täglich Brot gibt, dann kann man sagen: „Ich bin zwar nicht ins Paradies gekommen, aber ich bin in ein besseres Land gekommen.“
PR: Wie siehst du denn dein Verhältnis zu Österreich heutzutage? Als was du dich verstehst, hast du mir gesagt, identitätsmäßig--
GC: --ich habe mir die österreichische Staatsbürgerschaft wiedergeholt, weil, weil…weil…jedenfalls nicht aus…wie sagt man, aus…Rache an den Verhältnissen oder an den Österreichern, das ist nichts, das führt zu nichts. Ich würde so sagen: ich bin über Österreich…ich werde keine Noten austeilen darüber, wenn ich sagen würde, ich bin mit Österreich zufrieden. Sagen wir mal so, ich habe meinen Frieden mit Österreich geschlossen, ob Österreich Wert darauf legt oder nicht. Ich war ja fünf Jahre in Österreich als Presseattaché in der Botschaft in Wien und das war eine ganz andere Zeit. Das waren die späten [19]60er-Jahre und die Generation…die Tätergeneration, whatever Täter means…und zu den Tätern soll man nicht nur die zählen, die in den Lagern Aufseher waren. Die Tätergeneration war keineswegs vorbei. Die waren alle noch da und sie hatten sich gegenseitig die Pöstchen zugeschustert.
3/00:52:37
Und die Sozialdemokratie war noch gar nicht…hatte sich noch nicht profiliert, salonfähig gemacht…und dazu hat es eben Kreiskys bedurft. Und ich habe damals gefunden, dass die Österreicher, irgendwo unterschwellig, das für ihre Wiedergutmachung par excellence angesehen haben: „Jetzt haben wir einen Juden als Bundeskanzler, jetzt kann uns keiner mehr was anhaben.“ Und dann haben sie den [Kurt] Waldheim gewählt. [Lacht.] Ich meine, das sind halt die zwei Seiten der Medaille gewesen. Jedenfalls damals hatten wir sehr gute Bekannte, Freunde, Österreicher, aber das war eine andere Situation. Ich war damals der Herr Presseattaché von der amerikanischen Botschaft. Der hiesige Pressechef damals, mit dem ich gesprochen habe, bevor ich hinfuhr…den Posten aufnahm, habe ich gefragt: „Was glauben Sie, wie soll ich mich denn in Österreich verhalten als ehemaliger Österreicher?“ Und er hat mich angeschaut und er hat mir gesagt: „Ganz einfach: Sie sind der Presseattaché der Botschaft der Vereinigten Staaten von Nordamerika.“ Dann sagte ich: „Und?“ Sagt er: „Sie sind der Presseattaché der Botschaft der Vereinigten Staaten von Nordamerika, das sind Sie und so sollen Sie sich den Österreichern gegenüber verhalten.“ Das war ein sehr guter Ratschlag. Und es war wiederum einmal ein isoliertes Leben, denn wir haben diesmal in Oberdöbling gewohnt und haben es uns gutgehen lassen. Und ich war, wer immer ich sein wollte. Und wann immer mir so ein Österreicher in die Quere kam, dann konnte ich ihn so behandeln wie der Herr Presseattaché, wenn ich wollte. Aber es war jedenfalls ganz anders, denn die Leute, die gleichaltrig waren, hatten ihr eigenes Profil noch nicht gewonnen und die Leute die älter waren, behandelten mich und meine Altersgenossen, wer immer sie waren, wie Überschuss…Ausschussware. Und es waren immer eigentlich sehr unsympathische Leute.
3/00:56:23
Und wie dann der Kreisky gekommen ist, wurde es anders. Die bekamen es mit der Angst…und die Jungen bekamen Aufwind. Und dann sind wir aber schon wieder weggegangen. Wir waren dann lange Zeit nicht in Österreich, längere Zeit nicht in Österreich und waren eigentlich dann sehr überrascht, dass sich zumindest Wien ganz ordentlich geändert hatte…von dem Wien, das wir damals in den [19]60er- und [19]70er-Jahren kannten. Und, dass auch draußen auf dem Land sich einiges irgendwie weltoffener angefühlt hat und dass die Leute Weltsprachen konnten und dass sie freundlicher waren und, vor allem, dass es ihnen besser ging. Und, dass sie sich nicht mehr auf das konzentrieren mussten, was früher den Österreichern…worauf man sich früher konzentrieren musste, denn ganz…eine Art, wie Österreicher sich verhalten haben zu der Zeit, wo wir dort waren…das war in diesem Fall, den ich jetzt erwähnen werde, war es an sich ein zuagraster [zugereister] Böhm [Böhme], aber doch aus demselben Milieu. Das war unser Büro leader und jeden Morgen, wenn ich ins Büro kam, begrüßte man sich und eines Tages sagte ich zu ihm: „Guten Morgen, Herr Joseph, wie geht es Ihnen?“ Normalerweise habe ich immer nur „Guten Morgen“ gesagt. Und ich sagte: „Wie geht es Ihnen?“ Und er sagte: „Nicht so gut wie Ihnen, Mister Czuczka.“ Und ich habe gedacht: das musst du doch nicht sagen. Aber er hat es gesagt und so waren…ich meine, es hat mich dann doch nicht gewundert, dass er es gesagt hat. So war es damals schon, dass die, die unter dir waren, dich so behandelt haben und die, die über dir waren dich anders behandelten…immer mit Trittbrettfahrer und Radfahrer und diese ganzen Sachen. Ich glaube, das hatte sich schon einigermaßen geändert. Ich glaube, das erste Mal waren wir dann 19…nach der Wende wahrscheinlich dort und da hatte es sich schon sehr geändert. Nein, ich bin dann noch mehrmals alleine in Wien gewesen, um den Onkel zu besuchen. Aber jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren, da hat sich sehr viel geändert. Es ist ja wirklich weltstädtisch geworden in Wien. Und es ist nicht alles sympathisch, was sich da zeigt und ich könnte mir den Kohlmarkt auch anders vorstellen.
Und ich mag auch die Arschkriecherei nicht, die man in Wien antrifft. Und ich mag auch das Verpulvern, den Verschleiß von Wien als Konsumartikel nicht, aber ich mag auch vieles an Amerika nicht. Aber ich glaube…und ich muss sagen, dass ihr, es hat auch dazu beigetragen. Ich habe jetzt seit zehn, zwölf Jahren Kontakt zu den Gedenkdienern gehabt. Und ich weiß, dass ihr nicht die Österreicher seid…bestimmt nicht. Ich brauche nur euer Blatt zu lesen, um das herauszulesen, wenn ich es nicht wüsste. Aber immerhin, ihr seid das Produkt österreichischer Schulen und österreichischer Universitäten unter Umständen, österreichischer Familien. Es könnte viel schlimmer sein und demzufolge…ich gehe nicht mit einem chip on my shoulder nach Österreich, wie viele es früher und auch heute noch tun und die alle Österreicher in einen Topf werfen. Denn ich weiß es aus meinen eigenen Erfahrungen, aus meinem eigenen Leben, dass es nie so war.
3/01:02:57
PR: Hast du dir einmal überlegt permanent zurückzugehen?
GC: Ja schon…es ist sehr schwer, wenn du…du müsstest ein weit breiteres Umfeld haben. Weil…ich meine, ich könnte natürlich nach Wien zurück. Ich kenne mich in Wien genauso gut aus wie jeder Wiener und ich weiß auch, wo man hingeht und wo man nicht hingeht, wo es schön ist und wo es nicht schön ist. Aber du brauchst ja schließlich mehr als Ortskenntnis und ich denke schon, wenn ich über die Jahrzehnte zurückblicke: warum musste das alles enden? Warum hätte ich nicht auch in Österreich aufwachsen können? Und warum wäre ich nicht ein Journalist in Wien gewesen bei der Neuen Freien Presse – oder bei der Roten Fahne eher? [Lacht.] Aber du brauchst schon mehr dazu. Und das ist das, was ich dem Hitler bis an mein Lebensende nicht verzeihen werde, denn die…meine richtige Heimat, das kann ich nicht von hier sagen und ich kann es aber auch nicht von dort sagen. Und das ist das, was dich richtig begleitet und dich zuweilen verfolgt, dein ganzes Leben lang. Und dorthin zugehen…was ich dort verloren habe, das weiß ich. Aber ich habe nichts verloren, ich habe dort nichts verloren und das…that is the way it is.
Ende von Teil 3
Teil 4
PR: Kannst du mir ein bisschen etwas über deine Zeit in Camp Ritchie erzählen? [19]44/[19]45, da hast du ja gemeint, dass du mit anderen deutschsprachigen Emigranten dort zusammen warst. Kannst du mir über die Rahmenbedingungen und was dort geschehen ist ein bisschen berichten?
GC: Camp Ritchie ist in den Bergen von Maryland und es erinnert, sagen wir, an…wahrscheinlich an das Waldviertel oder was ähnliches…Voralpen. Und es war immer als country club of the Army bekannt, weil in dem Trainings-, Ausbildungslager war ein sehr schöner See und die Offiziere sind dort mit ihren Damen baden gegangen oder sind mit den Ruderbooten oder Kanus herumgefahren. Wir gemeine Soldaten haben das zunächst überhaupt nicht tun können. Ich bin im Winter [19]44/[19]45 hingekommen, hatte eigentlich schon erwartet, als ich eingezogen wurde, dass ich dort unter Umständen landen könnte. Wegen meiner Sprachkenntnisse, die sich auf die deutsche Sprache und bestenfalls ein bisschen Latein und ein bisschen Griechisch erstreckt haben. Aber das Lager war dazu…war eines der Lager von, ich glaube, zwei oder drei, die Soldaten ausgebildet haben, um Kriegsgefangenenverhöre durchzuführen. Und man hat ganz regelrechte Kurse besucht. Der Dienst mit der Waffe war minimal. Man hat mehr mit…zum Beispiel mit der…order of battle von den Deutschen, von den deutschen Streitkräften, musste man sich vertraut machen…und die Aufstellungspläne von der SS und die verschiedenen Dienstränge. Und wir waren eigentlich zu diesem Zeitpunkt…wie gesagt, Winter [19]44…wir waren schon ganz allgemein…es war uns allen schon ganz allgemein bekannt, dass es Konzentrationslager gab und dass die SS in der Hauptsache in den KZs war, aber das draußen eben die Wehrmacht mit ihren Soldaten im Feld war. Und es spielte sich so ab, dass vielleicht 30, 40 Jahre bevor man role-playing als eine ganz normale Ausbildungsform kannte…wir hatten Deutsche…wir waren alle Deutsche und Österreicher, jedenfalls in dem Teil von dem Lager, in dem ich war. Und wir hatten Deutsche, die Kriegsgefangene spielten und wir hatten Deutsche und Österreicher, die Verhörmenschen spielten. Ausgewechselt hat man das nicht, es waren immer dieselben, die waren schon gedrillt und einstudiert darauf. Und man saß dann in einzelnen kleinen Zimmerchen und verhörte diese Leute. Und die verhielten sich so, wie die Kriegsgefangenen unter der Genfer Konvention sich zu verhalten hatten oder haben.
4/00:05:17
Nämlich, sie sagten nicht mehr aus als: „Ich heiße sowieso, mein Rang ist der und der und ich gehöre der zwölften Panzerdivision an.“ – „Wo ist die Panzerdivision stationiert?“ – „Das muss ich Ihnen unter den Bestimmungen der Genfer Verträge nicht sagen und Sie können mich auch nicht dazu zwingen!“ – „Das müssen Sie sagen!“ – „Nein, ich sage es Ihnen nicht!“ Und so ging das dann hin und her. Und diese Leute waren genau solche Amerikaner wie wir und haben das sehr gut gespielt. Und deine Aufgabe war es dann, die irgendwie zu dirigieren oder ihnen irgendwie klar zu machen, dass es keinen Sinn hatte zu leugnen oder nicht die Informationen nicht preiszugeben. Aber es war schwer und man konnte ja keine Gewalt anwenden, schon gar nicht diesen Leuten gegenüber, die ja unsere Kameraden waren.
Ja, das hat man gelernt und dann sind wir auch auf Feldübungen gegangen. Und zwar haben wir da…sie hatten dann Kriegsmaterial aus Europa bringen lassen – Panzer, Schützenpanzer und Derartiges. Und wir saßen dann irgendwo im Gelände und mussten beobachten, was da unten vor sich ging. Und da fuhren dann Schützenpanzer vorbei, deutsche, meisten Teils müssen die vom Afrikakorps gewesen sein. Die waren hellgelb angestrichen – mattes Gelb, für die Wüste wahrscheinlich – und wir mussten dann von da oben manchmal mit, manchmal ohne Fernglas, diese Fahrzeuge identifizieren. Der ganze Lehrgang dauerte, ich weiß nicht, zwei Monate und dann hatten wir eine Übung, bei der wir eine topographische Landkarte bekamen, von der Gegend, in der wir da waren in Maryland. Aber es standen keine Ortsnamen drauf. Und es stand auch nicht drauf wo…wir wurden ausgesetzt im Gelände, irgendwo, abends, vielleicht sogar bei Nacht, und man gab uns diese Landkarte und wir wussten auch nicht unbedingt, wo der Treffpunkt war, den wir finden sollten. Oder vielleicht wussten wir es schon, aber es war jedenfalls von dieser Landkarte nichts zu erkennen. Und so gingen wir da auf der bestimmten Übung, an der ich teilnahm…gingen wir dann bei Nacht durch das Gelände und hatten keine Ahnung wo wir waren, hatten einen Kompass, aber der hat uns sehr wenig genützt. Und wir wanderten dann herum, irrten eigentlich viel mehr herum und schließlich sahen wir dann irgendwo in der weiteren Umgebung ein Haus wo Licht war und wir gingen auf das Haus zu und einer von uns sagte: „Klopfen wir doch an und fragen wir die wo wir sind.“ Und wir sagten, „Nein, das dürfen wir doch nicht!“ Wir waren so fünf Mann. Jedenfalls, der eine sagte: „Ich gehe hin und frage die.“
4/00:10:12
Er klopfte an und es kam ein Mann raus und der sagte „Oh, Sie sind vom Camp Ritchie? Sie sind auf der Nachtübung?“ Und da sagten wir: „Ja.“ Da sagte er: „Wo sollen Sie sich denn treffen? In Chambersburg?“ Und wir sagten: „Wir wissen es nicht!“ Und er schaute sich die Karte an und sagte, „Ach, Sie sind bei der japanischen Nachtübung!“ Und wir hatten gar nicht bemerkt, dass da überall japanische Schriftzeichen auf der Landkarte waren. Und er sagte: „Wissen Sie, das ist die japanische Übung und ich kann wirklich nicht sagen, ich weiß nicht, vielleicht ist es Chambersburg, aber ich weiß wirklich nicht wo es ist. Aber der Highway, der ist da unten. Gehen Sie doch mal auf dem Highway und Sie können ja sehen, ob Sie da richtig hinkommen.“ Und uns war gesagt worden: „Unter keinen Umständen auf der Landstraße!“ Und es wurde später und später und wir gingen da durch das Gestrüpp hinunter. Und schließlich sagte unser Anführer, der wahrscheinlich ein Sergeant war, sagte, „Jetzt gehen wir auf den Highway und wenn wir als Erste oder als Letzte ankommen, das ist mir wurscht [egal], mir ist es schon genug mit dieser Übung.“ Was konnten wir tun, wir gingen mit.
Und wir gingen jetzt auf dem Highway und da kam ein Laster und unser Sergeant winkte und der blieb stehen. Er sagte…wir waren natürlich in Uniform, aber so in der Arbeitsuniform…und er sagte: „Wo gehen Sie hin?“ Und da sagten wir: „Wir wissen es nicht genau!“ Und da sagte er: „Dann kann ich Ihnen auch nicht gut sagen, ob ich da hinfahre, wo Sie hinwollen. Haben Sie eine Karte vielleicht?“ Jetzt gab der Sergeant ihm die Karte. Er guckte sich die Karte an und sagte: „What the hell is this?“ Er sagte dann, „Kommt nur rauf in den –“…wie heißt denn das…vorne wo er sitzt…Kabine…ein Laster, also ein großer Laster und wir zwängten uns da vorne daneben hin und er sagte: „Wer seid Ihr denn eigentlich?“ Und da meldete sich der Mann zu Wort, der den dicksten deutschen Akzent hatte. Und er sagte: „We are American soldiers.“ [Spricht mit deutschem Akzent.] Er sagte: „You are American soldiers? I don’t think so.” Und wir fuhren jetzt…wir hatten keine Waffen bei uns, also wir hätten ihn nicht in Schach halten können. Und wir fuhren mit ihm und hatten nicht gesehen: zwei Kilometer weiter war eine Sperre und da war unser Ziel. Und er sagte: „Wait just a minute!“ Und er sprang raus und lief zu denen hin und sagte…die erzählten uns das später…und sagte: „Ich glaube, ich habe da fünf Deutsche“, – heute würde man sagen: Terroristen –, „gefangen und ihr müsst euch dieser Leute annehmen, das ist ein toller Fang!“ Die haben uns dann runtergeholt…haben uns gesagt: „Das hättet ihr nie tun dürfen, ihr hättet nicht auf die Landstraße gehen sollen!“ Und wir wurden dann bei dieser Übung als Letzte eingestuft.
4/00:15:10
Ansonsten war es eigentlich eine recht fidele Art den Krieg zu verbringen. Und nach diesen paar Monaten wurden wir dann nach Europa geschickt. Und die Leute, die vor uns diesen Lehrgang durchgemacht haben, bekamen auf der Stelle einen Offiziersrang. Aber wir, weil der Krieg schon praktisch vorbei war, bekamen ihn nicht. Und ich habe die amerikanische Armee absolviert als gemeiner Soldat, vom Anfang bis zum Ende, und habe dann allerdings, wie wir bei diesen verschiedenen…wie ich dann auch bei den Kriegsverbrecherprozessen war und auch schon vorher bei dieser kleinen Einheit, die in der Kultur-Sphäre gearbeitet hat…da hatte ich immer Offiziers-Uniform an und konnte mich als Offizier fühlen, aber war es nicht. Und, wie gesagt, ich wurde dann auch als gemeiner Soldat entlassen.
PR: Du hast vorhin erwähnt, dass im Camp Ritchie schon klar war, dass es Konzentrationslager gibt, wer diese Konzentrationslager führt. Wie bist du das erste Mal mit Informationen aus Europa in Kontakt gekommen, die darauf aufmerksam gemacht haben, was wirklich in Europa geschieht?
GC: In der Hauptsache war es ja so, dass…ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber der Bruder meines Vaters wurde nach dem Tod meiner Großmutter, mit der er zusammen noch in Wien gelebt hatte…wurde er offenbar auf die Abschussliste bei der Kultusgemeinde gesetzt, weil es gewissermaßen nicht mehr nötig war, dass er diese alte Frau betreut. Und er schrieb uns aus Wien, bevor er verschickt wurde. Insgesamt sind es nach unserer Emigration im Jahr [19]39 bis zu seiner Verschickung im Jahr [19]41…waren es etwa 60, 80 Briefe, die er uns geschrieben hat. Und in den Briefen war ganz klar und deutlich zu sehen, wie das Ganze voranging mit den…auch mit den Verschickungen. Denn es kam ja dann der bestimmte Zeitpunkt, an dem Leute tatsächlich nach Polen verschickt wurden. Außerdem war mein Vater im KZ gewesen, der Onkel war auch im Rahmen der Kristallnacht im KZ gewesen, sie waren beide im Krieg gewesen, im Ersten Weltkrieg, und ich glaube, sie hatten beide keine besonderen Illusionen, was da auf sie zukam. Wir haben dann in diesen Briefen vom Onkel oder von anderen Verwandten, die wir in Wien, in der Slowakei, in Ungarn hatten…war zu ersehen, wie die Nazis operierten. Ja, die Briefe von diesem Onkel rissen dann eine Zeit lang ab, nachdem er…er schrieb in einem Brief: „Ich muss mich melden“, und schrieb dann noch aus der Karajangasse in Wien, wo mein Vater auch in dem Sammellager gewesen war, bevor er ins KZ kam. Er schrieb dann in diesem einem Brief aus der Karajangasse, in dem er schrieb: „Ich bin jetzt da, wo Fritz“ – das war der Name meines Vaters –, „wo Fritz auch war, bevor er auf seine Reise ging.“ Und der nächste Brief kam dann aus Opole. Und er schrieb über die Eisenbahnfahrt von Wien nach Opole und schrieb dann was er dort vorgefunden hatte. Und hatte aber immer noch – auch dort noch – den Glauben nicht verloren, war optimistisch genug zu denken, dass wir und er, der eben schon weitgehend Papiere hatte…es ging dann um Schiffskarten, ob ein Amerikaner für ihn die Schiffskarten kaufen würde. Dann ging es darum, sollten sie von Europa fahren, er und die Großmutter und dann er allein. Sollte er über die Sowjetunion, nach Asien, nach Japan, nach Shanghai…irgendetwas.
4/00:22:09
Und er glaubte immer noch daran. Er hatte vor seiner Verschickung…Gespräche mit…[Josef] Löwenherz. Kam zu Löwenherz vor…war zu dem Zeitpunkt schon krank und Löwenherz sagte zu ihm…schrieb er: „Was glauben Sie, man wird jemanden wie Sie hier halten? Ist doch überhaupt keine Rede davon, dass man für Sie sich gewissermaßen verausgaben will.“ Er hat nichts Gutes über Löwenherz zu sagen gehabt. Jedenfalls, er hat dann, im späteren Verlauf, bis zur Invasion der Sowjetunion, wo es dann überhaupt abriss…hatte er dann schon immer wieder Andeutungen gemacht, dass Leute von dort weggeschickt worden waren, dass Neue kamen und wie gedrängt es schon war und dass dann die polnischen Juden schon weggeschickt worden sind, man weiß nicht wohin. Zwischen der Zeit und der Zeit, wo ich dann im Camp Ritchie war, waren ja zweieinhalb Jahre vergangen und es war eigentlich…meine Eltern, mein Vater zumal, hatte sich überhaupt keine Illusionen gemacht, dass der Onkel jemals wieder lebend zurückkommen würde. Und wir wussten auch – oder er wusste auch – zu viel über die Nazis, als dass er glauben hätte können…dass er geglaubt hätte, dass da irgendetwas gut gehen könnte, dass der Onkel beispielsweise oder Tausende andere, von denen man ja auch…ich meine, nicht von Tausenden, aber aus der Familie, Tanten, Onkel, die dann eben auch schrieben – und dann nie wieder schrieben. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir genauestens wussten: „Es gibt da Lager, die heißen Auschwitz, Treblinka, Stutthof.“ Aber, dass man gesagt hat: „Wenn die einmal diese ganzen Leute in ihrer Gewalt haben, was wollten die denn mit denen machen?“ Ich meine, wo sollten sie denn diese Leute hinschicken, wo sollten sie die denn festhalten, in den Ghettos? Würden sie ihnen zu Essen geben? Würden sie sie arbeiten lassen? Hätten die irgendwie eine Verdienstmöglichkeit? Das war ja einfach nicht drin. Also ich würde so sagen: Ganz genau wusste ich es dann natürlich in Ritchie, weil wir schon, glaube ich, Namen von Lagern wussten, zu dem Zeitpunkt. Und das wirft immer wieder dieselbe Frage auf: Wenn man das alles gewusst hat, warum hat man nicht bombardiert?
4/00:26:19
Die Franzosen haben sich schon gefragt beim Ausbruch des Krieges, ob sie für Danzig sterben sollten. Und ob die Engländer oder die Kanadier oder die Australier oder sonst wer…oder die Exil-Polen gesagt hätten: „Ja, wir wollen die Juden befreien“, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, es war in dem Moment, wo der Angriff auf die Sowjetunion startete…war es uns in unserem kleinem Ambiente war es uns klar, dass man die Leute nicht wieder sehen würde. Das Fazit ist, dass man einige von den Leuten ja wiedergesehen hat und dass sie es überlebt haben, aber dass viele andere es nicht überlebt haben. Einer von meinen Vettern hat sogar Auschwitz überlebt, ist dann zurücktransportiert worden nach Buchenwald, war beim Bombenangriff auf Weimar in dem Zug, der auf dem Weimarer Bahnhof gewartet hat, wurde schwer verletzt, ist in Weimar…in Buchenwald irgendwie zusammengeflickt worden und hat es dann noch 25 Jahre lang oder 30 überlebt. Es war Glückssache, absolut.
PR: Du hast mir erzählt, dass du nach dem Camp Ritchie nach Bad Schwalbach gekommen bist und dort in einer Entnazifizierungskommission tätig warst.
GC: Nein, wir wurden gewissermaßen dort…es kam ein ganzer Schub aus Camp Ritchie über Frankreich nach Bad Schwalbach. Und wir waren dort vielleicht 200 oder 300…200 vielleicht…Absolventen von Camp Ritchie. Und es kamen dann von verschiedenen Einheiten in Deutschland und wahrscheinlich auch aus Österreich…kamen dann irgendwelche Offiziere, die sagten: „Wir brauchen sechs Leute für unsere Dienststelle in Passau“ oder „für die oberste Entnazifizierungsbehörde in Berlin“ oder „in München.“ Und die haben sich dann die Personalakten von den Leuten angesehen, haben dann persönliche Gespräche, Interviews gemacht, und wenn sie fanden, das passte richtig zusammen, dann sagten sie: „Wir werden Ihre Versetzung da- oder dorthin veranlassen.“ Und ich wartete dort eine Weile mit vielen anderen und wir wurden interviewt und einmal, da kam ich auf kurze Zeit…zu einer Kriegsverbrecherkartei, Sammelkartei in Wiesbaden, wo einige von den Nürnberger Prozessangeklagten im Gefängnis festgehalten wurden, aber wir waren nicht in den Zellen, sondern draußen und haben die Kartei durchgesiebt. Und das dauerte ein paar Wochen und dann ging ich wieder zurück nach Schwalbach. Und da wurde ich von diesen Leuten ausgewählt die…wo ich dann im Spessart tätig war. Und das dauerte…diese Stelle, das war eine ganz kleine Einheit, maximal fünfzehn, zwanzig Leute…und war so ein Lieblingskind von diesem Psychologen aus New York, der unbedingt feststellen wollte – wissenschaftlich feststellen wollte – was einen Nazi ausmacht. Nämlich auf der Basis von [Max] Horkheimer/[Theodor W.] Adorno The Authoritarian Personality.
4/00:31:36
Und der andere Mann, der aus dem Elsass war, der war ein OSS [Office of Strategic Services]-Mann, war mit Fallschirm in Deutschland abgesprungen, hat sich irgendwie durchgeschlagen und hat mit irgendeiner Résistance-Gruppe, also Widerstandsgruppe, in Deutschland Kontakt gehabt. Und er hatte mehr oder weniger das Politische und das Ideologische bei den Verhören, die sie mit diesen Leuten machten, festzustellen. Und der Psychologe gab ihnen Rohrschach-Tests. Und wie sie nun die Rohrschach-Tests bestanden oder nicht bestanden, das führte dann zu dem Bild…dem Nazi-Bild…auf diesen Tintenklecksen konnte man das feststellen. Und diese Dienststelle wurde dann nach Oberbayern verlegt, für ganz kurze Zeit, vielleicht für einen Monat, und dabei behandelte man, glaube ich, in der Hauptsache Leute aus Bayern, aus Süddeutschland. Und dann ging ich zur CIC [Counter Intelligence Corps] in München und war ungefähr ein Jahr, ein Jahr wahrscheinlich, in München bei der CIC und da änderte sich mitten in meiner Diensttour der Focus von Nazi auf Sowjet. Und wir begannen die Roten zu jagen.
Es war ganz interessant, weil ich das gar nicht für so wichtig hielt. Ich habe gedacht, die sind unsere Verbündeten. Weil es ging dann auch…es ging eigentlich auf zwei Gleisen weiter, aber gegen die Nazis war es schon nicht mehr so scharf, aber gegen die Roten, gegen die Sowjets mehr als alles andere. Und die Leute aus den Satellitenstaaten, Geheimagenten. Und das war eigentlich noch in den Kinderschuhen, das war noch lange vor dem richtigen Kalten Krieg. Das war noch während ich in der Armee war und ich konnte dann raus nach dreijähriger Dienstzeit, im Jahr [19]47, und bewarb mich für einen Posten bei den Kriegsverbrecherprozessen in Dachau. Nürnberg war zu dem Zeitpunkt schon vorbei und ich blieb dann noch ein Jahr in Dachau und machte dort die Verhöre mit SS-Leuten und dergleichen. Darüber habe ich ja schon gesprochen.
4/00:35:20
PR: Du hast auch ganz kurz erzählt, dass du beim zweiten Buchenwald-Prozess mit dabei warst. Was war deine Tätigkeit im Rahmen vom Buchenwald-Prozess?
GC: Ich habe da nicht mitgearbeitet, der fiel ja…der fand zu der Zeit statt und ich konnte, wann immer ich Zeit hatte oder Lust darauf, konnte ich, weil ich ja schließlich ein eigenes Interesse hatte, weil der Vater ja dort gewesen war, konnte ich dem Prozess ab und zu einmal beiwohnen. Was damals…meine Haupttätigkeit bestand darin, die SS-Leute, die noch im Lager in Dachau saßen – es waren Deutsche und auch natürlich Volksdeutsche – zu verhören, um zu sehen, ob ein…genügend Material vorhanden war, um denen den Prozess zu machen. Und ich arbeitete da mit zwei…beides Kavallerie-Offiziere, polnische, die ganz…in den ersten zwei Wochen des Krieges gefangen genommen worden waren von den Deutschen und, ich glaube, vier Mal aus deutschen Kriegsgefangenenlagern ausgebüxt sind und beim vierten Mal ist es ihnen gelungen. Und sie sind dann entweder zu den Amerikanern oder den Engländern übergelaufen. Waren sehr nette Burschen, ungefähr so alt wie ich oder ein bisschen älter. Und wir drei machten die Verhöre. Die konnten beide ausgezeichnet Deutsch, Polnisch brauchten sie gar nicht zu können. Und wir arbeiteten mit einem Anwalt, einem amerikanischen Ankläger, der sich unser Material von den Verhören ansehen konnte und sagen konnte: „Das passt“ oder „das passt nicht.“ Können wir diesem Mann da einen Prozess machen? Sind da Querverbindungen zu irgendwelchen anderen? Und er hat dann eben diese…Anklageschriften verfasst und, wenn überhaupt, sind manchen, vielen von denen, die wir da verhört haben, der Prozess gemacht worden oder nicht. Die Tatsache war die, dass wir zum Beispiel…in einer gewissen Weise zeigt es den Mangel an Verständnis und Kompetenz, wie diese Sache da, mit dieser Nachtübung…zeigt es…wir bekamen eines Tages eine lange Liste vom Hauptquartier in Augsburg – die waren für Dachau verantwortlich. Und auf dieser Liste stand: „Die folgenden Gefangenen“, also SS-Männer, „sind innerhalb von 48 Stunden zu entlassen, falls nicht irgendwelche zwingenden Beweise gegen sie vorliegen.“ Und wir haben die Liste in die Hand bekommen, wahrscheinlich mit Boten, und setzten uns sofort hin und gingen die Liste durch. Und da waren fünf Leute drauf, die zu derselben Zeit auf der Anklagebank im zweiten Buchenwald-Prozess saßen. Wenn man die entlassen hätte, gegen die lagen Verbrechen vor…Anklagen vor, für die sie später…ein paar wurden aufgehängt. Und wir haben sofort telefoniert und gesagt: „Nein, um Gottes Willen, diese Leute können nicht entlassen werden!“ – „Dann schaut euch die Liste noch genauer an! Wir müssen sie ja nicht entlassen, aber wir haben die Order von weiter oben bekommen.“ Von wem, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir dann wie die Irren – mehr oder weniger turnusmäßig – in den 48 Stunden die ganzen Akten alle durchgesiebt, haben dann die Leute zum Verhör geholt, die wir noch nicht verhört hatten und haben dann vielleicht die Hälfte von den Leuten zurückgehalten. Andere Leute sind entlassen worden. Ob die falsche Papiere hatten…weiß der Teufel, was sie waren.
4/00:41:19
Und es hat zum Beispiel auch…in Dachau gab es einen Fall, wo wir eine…ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt…ein police lineup, wo die…nicht Leichenschau, sondern eine Vorführung, wo man verschieden Leute auf die Bühne stellt und sagt: „Wer ist da?“, laut dem Zeugen, „identifizieren Sie den Mann, der den Mord verübt hat!“ Und in diesem Fall war es so, dass man hier verschleppte Personen, displaced persons – Juden, Polen, Ukrainer, wer immer sie waren – eingeladen hat nach Dachau zu kommen, in das Theater, das in Dachau existierte und hat diese SS-Männer – so fünf, sechs – jeweils vorgeführt. Die ehemaligen Häftlinge saßen im Zuschauerraum, der abgedunkelt war, die Scheinwerfer waren auf die Bühne gerichtet und man sagte dann: „Sagen Sie uns, ob Sie einen dieser Leute erkennen.“ Und man wusste ja, wo die gewesen waren und dann konnte man sagen: „OK, das ist eine richtige identification und wir können gegen diesen Mann vorgehen.“ Und bei jeder Gelegenheit führte einer von unseren Leuten…ein Holländer führte eine Gruppe vor und plötzlich erschallte aus dem Zuschauerraum der Ruf: „Ja, das ist er!“ Und der Holländer sagte: „Welcher?“ Und da sagte er: „Du!“ Und wir haben ihm dann gesagt, das muss ein Irrtum sein und so. Und dann haben dann einige Leute dort in Dachau…also von unseren Leuten…wir hatten schon ein bisschen Zweifel und haben ihn dann ein bisschen näher befragt und er sagte immer: „Nein, ich bin das nicht!“ Aber am Abend hat er sich aufgehängt – und er war es doch. Das waren dramatische Begebenheiten da.
PR: Danach bist du ja ans Dokumentationszentrum nach München zurückgegangen. Was hat sich dort abgespielt und--
GC: --das war white-collar work. Da war nix [nichts] mehr, also Dramatisches hat sich da nicht ereignet.
PR: In den [19]50ern war es dann so, dass du wieder nach New York zurückgekommen bist. Da hast du ja gesagt, dass du…weißt du, wo du in New York gewohnt hast, als du in den [19]50ern zurückgekommen bist?
GC: Ja, da war ich…ich habe meine Frau im Spessart schon getroffen gehabt und wir haben dann geheiratet und wir sind dann schon als Ehepaar nach New York gekommen. Und wir haben zuerst auf der West Side gewohnt am Central Park und…dann sind wir hinausgezogen nach Riverdale. Und Riverdale ist eine Nobeladresse, also wie, was soll ich sagen…wie Cottage in Wien. Aber dem ist nicht so, denn es gibt verschiedene Teile von Riverdale. Wir hatten einem sehr guten Freund, der immer darauf bestanden hat, wenn er uns einen Brief geschrieben hat…hat er immer die Adresse geschrieben und dann: The Bronx, New York. Riverdale hat er nie geschrieben. [Lacht.] Und dort haben wir dann in einer einfachen Zwei-, Drei-Zimmerwohnung gewohnt. Meine Frau ist dann auch arbeiten gegangen und ich bin in die Universität gegangen. The rest is history. Dann bekam ich den Job bei der Voice of America und dann ging es so weiter, eben im Foreign Service.
4/00:46:41
PR: Was hast du im Foreign Service gemacht, also du hast dann--
GC: --ich habe RIAS…und das war vier Jahre lang. Und RIAS hatte drei Hauptabteilungen: die Politik, die Musik und das sogenannte kulturelle Wort. Und das kulturelle Wort beinhaltete Kinderfunk, Jugendfunk, Frauenfunk, Literatur, Hörspiel, Kabarett und solche Sachen. War sehr hübsch und sehr interessant. Politisch…natürlich war es ein Propaganda-Sender, da gibt es nichts, wir haben nie einen Hehl daraus gemacht bei RIAS. Und Berlin war…also ich als, was weiß ich, als linker Mensch aufgewachsen, habe dann auch die Schattenseiten von der Sowjetunion und vom Stalinismus aus nächster Nähe miterleben können. Und in Berlin zu leben in dieser Zeit – in der Glanzzeit des Kalten Krieges – war nicht besonders angenehm. Dass man das Gefühl hatte man sitzt auf der Zielscheibe, obwohl ich nie daran glaubte, dass die Russen losmarschieren würden. Und man hat auch immer gedacht: „Wir würden ja ausgeflogen werden!“ Oder: „Wir wären ja exterritorial.“ Aber es ist nicht sehr angenehm in einer umzingelten Stadt zu leben – auch vor der Mauer. Und jedes Mal, wenn man rausfuhr durch sehr scharfe, unangenehme, unsympathische Grenzkontrollen…zu müssen. Und dann konstant das Gejeier [Gejammer] von den Berlinern sich anzuhören: „Lasst Ihr uns im Stich?“ Und: „Tut das doch nicht“ und „wir sind doch…und Ihr müsst uns“ und die Luftbrücke…aber trotzdem. Die Arbeit war an sich sehr interessant, weil es interessante Leute gab: Literaten und Kabarettisten und auch die heranwachsende jüngere Generation in Deutschland.
Und da ging ich dann von Berlin nach vier Jahren für vier Jahre nach Essen, was in gewisser Weise noch interessanter war, weil ich da wiederum Westdeutschland in seiner unmittelbare Nachkriegsgestalt erlebte. Und da war es insofern ganz angenehm zu arbeiten, weil man wirklich…ich meine, das ist zwar eine Façon de parler, aber man konnte wirklich Brücken schlagen und man konnte…gerade da haben wir das Augenmerk sehr oft auf junge Zuhörer und Zuschauer gelegt. Und wir haben versucht Lücken auszufüllen, zum Beispiel in der Musik. So wie die österreichische Botschaft sich immer mit jüdischen Themen und Musik, wenn möglich, sogar jüdische Themen mit Musikbegleitung gefällt, so haben wir das auch getan: amerikanische Musik, amerikanische Künstler, amerikanische Theaterstücke und so weiter der neuen Generation nahezubringen. Und das war eigentlich sehr schön, eine angenehme und in gewisser Weise auch ersprießliche Tätigkeit. Und es hat Freude gemacht.
4/00:51:50
PR: Von wann bis wann warst du in Berlin?
GC: Von [19]56 bis [19]60 und von [19]60 bis [19]64 in Essen. Und dann zurück nach Amerika und wieder bei der Voice. Da machte ich Hörerbetreuung, was wieder einmal was ganz was anderes war. Dann bekam ich den Posten in Wien als Presseattaché und ich hatte dann wirklich schon…da war ich 48, wie das vorbei war und ich hatte eigentlich vor, in Frühpension zu gehen und habe es dann auch wahrgemacht. Wir waren dann noch die zwei Jahre in Indien und das war in gewisser Weise…ich meine, Wien war auch eine sehr feine Sache, insbesondere weil ich…weil unser Sohn, der, während wir dort waren, zehn…neun bis vierzehn war, war dann ungefähr so alt, wie…zum Beispiel die Schuschnigg-Zeit, die auch…den Dollfuß vergisst man fast, weil er so klein war…und dann auch das eine Jahr Nazi-Zeit…dass ich mit ihm meine eigene Jugend unter wesentlich besseren Voraussetzungen wieder erleben konnte, das war allein schon diesen Job wert.
Und was Indien betrifft: Indien ist, wie man in Amerika sagt: it is an education and a half. Wenn du einmal in der Dritten Welt gewesen bist…Indien ist ja jetzt schon fast gar nicht mehr Dritte Welt…aber wenn du da einmal richtig gewesen bist, auch wenn du als Privilegierter gelebt hast – ich bin sehr viel herumgekommen dank meiner Arbeit – dann weißt du, würde ich sagen, dass das, was du als junger Mensch zuhause gelernt hast, von A bis Z stimmt. Denn wenn du einmal siehst was Armut wirklich ist und wenn du einmal siehst, wie viele Menschen es auf der Welt gibt und dass sie alle nicht weiß sind, dann weißt du, dass das, was du von Kind auf gelernt hast, dass das stimmt. Und, dass eben alle Menschen werden…et cetera. Und das ist sehr wichtig und war mir sehr wichtig – und es hat auch uns allen nur gutgetan, dass wir dort waren.
Ende von Teil 4
Teil 5
PR: Du hast während des Interviews einmal gesagt – ich glaube, dass es da gut dazu passt, darum frage ich dich das jetzt –, dass es in deinen Augen wichtig ist, dass man seine Gesinnung nicht verliert. Was hast du damit genau gemeint?
GC: Mehr oder weniger, was ich gerade gesagt habe. Ja.
PR: Du bist dann in die Pension gegangen – das war wann?
GC: [19]75, da war ich genau 50 Jahre alt – ein Jüngling. [Lacht.]
PR: Und da ist es dann aber weitergegangen: Du hast gesagt, dass du Übersetzungen selber gemacht hast und auch einige Dinge selber geschrieben hast. Kannst du mir sagen, was du übersetzt hast, was du selber geschrieben hast?
GC: Ich habe zunächst einmal…wir sind dann nicht nach Amerika gegangen, im Jahr [19]75, sondern sind in die Festspielstadt Salzburg gegangen. Und wir hatten dort einen…einen Freund würde ich nicht sagen, aber einen guten Bekannten und der hat uns gesagt: „Ja, das Leben ist hier sehr schön.“ Er war auch Jude, hatte die Emigration sehr komfortabel in, ich glaube, Kolumbien erlebt und war dann zurückgekommen und war einer der wenigen verbleibenden Legitimsten. Und war dann sogar so etwas Ähnliches wie – jedenfalls hat er das gesagt – der Finanzberater des von ihm so betitelten Hohen Herrn. Das ist der Thronfolger. Und er hat gesagt…also er hatte auch andere Freunde und Bekannte. „Es lebt sich in Salzburg gut und schön.“ Und wir kannten Salzburg nur vom Durchfahren oder vielleicht zweimal oder dreimal übernachten. Wir haben uns dann gesagt…ich bin in Wien geboren, meine Frau ist zwar in Norddeutschland geboren, aber in Garmisch-Partenkirchen aufgewachsen, in einer Mischehe. Und Salzburg liegt mehr oder weniger geografisch in der Mitte und das müsste eigentlich hinhauen. Wir haben dann nach einigem Hin und Her eine wirklich sehr hübsche Wohnung in Salzburg gefunden und haben unseren Sohn eingeschult im Bundesgymnasium. Er war in Indien schon in die deutsche Schule gegangen und konnte perfekt Deutsch und hatte auch schon einen Background und die fünf Jahre in Wien haben ja auch einiges bewogen. Und so sind wir nach Salzburg gezogen und haben gefunden, dass der Freund vollkommen Recht hatte: Salzburg ist eine absolut wunderbare Stadt. Architektonisch unschlagbar, Barock unschlagbar. Quality of life sehr gut, Umgebung wunderbar, fad bis dort hinaus. Und auch…unmöglich in irgendeiner Weise dort Fuß zu fassen. Und als Ausländer in Salzburg zu leben…das kannst du schon. Da kannst du auf die Festspiele warten und warten bis die Leute aus Amerika oder sonst wo kommen und…oder du kannst warten bis die Festspiele kommen und dann nach Italien zu fahren, damit du in der Getreidegasse nicht erdrückt wirst von den Leuten. Dann hat der Sohn dort maturiert und wir haben dann gesagt: „Was machen wir jetzt?“
5/00:05:16
Und wir fanden dann, dass wir eigentlich doch am ehesten nach Amerika gehen sollten und das haben wir dann auch getan und sind zuerst aufs Land gezogen, in der Nähe von New York. Wir waren ja eigentlich…ich betrachtete mich immer als New Yorker…und haben da auch sehr hübsch in den Catskills gewohnt in einer kleinen Universitätsstadt. Unser Tony ist dort ins College gegangen. Das College wurde, während er dort war, aufgestockt…wurde eine Universität. Und das Leben war dort sehr schön. In Salzburg habe ich mich als Übersetzer beim Molden-Verlag verdungen und habe die Memoiren von Mosche Dajan übersetzt, was eine Viechs-Arbeit war. [Lacht.] Aber der Molden-Verlag hat dann auch nicht mehr das hergegeben was…auch finanziell hat er nicht mehr hergegeben, was wir eigentlich gebraucht hätten. Und wenn du in Frühpension bist, dann ist die Pension ja kleiner und dann sind wir eben von New York hierher gezogen und besagter Tony ist dann…nein, er hat seinen Bachelor gemacht in New York und ist dann zu SAIS [School of Advanced International Studies an der Johns Hopkins Universität in Baltimore/Maryland] gegangen und hat dort seinen Master gemacht in political science. Und ich habe dann hier, von diversen Regierungsstellen, Übersetzungen zu machen bekommen auf den verschiedensten Gebieten. Das war nur pocket money oder ein bisschen mehr als pocket money. Und dann bin ich aufgestiegen in…wurde bekannt, dass ich auch Synchronsprecher bei Fernseh…documentaries machen könnte. Das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht.
Und in der Zwischenzeit habe ich mich versucht als Autor. Schon in New York hatte ich mit einem Professor dort an der Universität…College…ein polnischer Jude aus Warschau, glaube ich, und der hat aus irgendeinem einem Grund Kontakte zu Opus Dei gehabt. Wahrscheinlich Umberto Eco – er wird ihn gekannt haben. [Lacht.] Er hatte dann die Idee…er und ich sollten eine Biografie vom polnischen Papst [Papst Johannes Paul II.] schreiben. Und ich sagte ihm: „Wie, ich? Woher? Ich weiß ja darüber gar nichts, wissen Sie etwas darüber?“ Und er sagte: „Also, wissen Sie, ich weiß schon einiges, bin ja schließlich Pole!“ Und warum brauchte er mich? Er brauchte mich, weil manche von den Schriften des Papstes…also damals, das war 1978, [19]77, ich weiß nicht, wann der Papst…anfing, aber er war schon in Amt und Würden. Jedenfalls: der Papst hatte gewisse Schriften verfasst, die aber nur auf Lateinisch, Italienisch, Polnisch, aber nicht Deutsch existierten. Und er wollte die nicht unbedingt selber übersetzten und sagte mir: „Du wirst die Sachen auf Deutsch übersetzen.“ Und das tat ich dann auch und er sagte mir dann, er wird ein längeres Vorwort schreiben und ich sollte dann quasi die verbindenden Worte, die Zwischentexte für die übrigen Kapitel schreiben. Und jedes Mal wenn wir uns zusammensetzten, kam er mit noch etwas, das ich da hineinnehmen sollte: „Recherchier das doch!“ Und schließlich wurde daraus tatsächlich ein Buch…er hatte einen Verleger. Und es wurde ein Buch daraus das, sagen wir, zu 60 Prozent Papst, zu fünfzehn Prozent er und zu 25 Prozent ich wurde. Und er hat sich den Vorschuss geben lassen. Und wie ich ihn dann fragte: „Wie ist denn das, was für einen Vertrag haben wir denn?“ – „Ich habe für dich unterschrieben.“ Das Fazit war, ich habe für die ganze Sache 600 Dollar bekommen und das Buch ist wirklich erschienen.
5/00:12:41
Wir bekamen einen vollkommen unmöglichen Titel. Es heißt: Toward a Philosophy of Praxis. Und ich weiß bis heute nicht ganz genau, was praxis im Soziologen-Jargon und im Philosophen-Jargon wirklich bedeutet. Das ist ein einigermaßen renommierter Verlag gewesen und der Verlags…publisher hat darauf bestanden, dass der Titel so heißen sollte. Und es hat kein Mensch gewusst, worum es da geht. Es gab auch keinen Untertitel. Und es kam noch dazu, dass zu der Zeit zwei große, vom Vatikan gutgeheißene Biografien von ihm erschienen sind. Ich habe noch vier oder fünf Exemplare und ich glaube, insgesamt sind 800 oder 1.200 verkauft worden. Aber es war eine interessante Tätigkeit, weil ich auf einem Gebiet lesen und recherchieren musste, das mir vorher überhaupt nichts bedeutet hat. Und dann später wollte ich…habe ich ein Buch projektiert zur Zeit von Reagan und wollte ein Buch schreiben, das mehr oder weniger zeigen sollte, dass Amerika auf dem falschen Weg ist und, dass mit dieser Art von Konservatismus Amerika seine…Grundprinzipien eigentlich im Stich oder hinter sich oder unter den Teppich gekehrt hat. Und ich bin nicht richtig weitergekommen mit dem Buch. Jedes Mal, wenn ich es irgendwem gezeigt habe, haben die Leute gesagt: „Daraus wird nichts. Der Mann ist so populär, das wird kein Mensch drucken wollen. Auch wenn es noch so gut ist – und wir finden es gar nicht so gut. Entweder müsstest du härter vorgehen und dann müsstest du ganz nach links gehen oder du müsstest es so allgemein verständlich machen, dass es völlig verwaschen sein würde. Und mit diesem [unklar] in der Mitte Dich durchzulavieren...das haut nicht hin!“
5/00:16:00
Da habe ich das Ding stehengelassen und habe mich dann aber an eine andere Sache gewendet: Mich hatte immer schon die Jung‘sche Psychologie angesprochen und es hatte ein Mann ein Buch geschrieben, das den Zusammenhang zwischen [Carl Gustav] Jung und der großen Politik nachstellt. Und es sind da diese…Schwachstellen bei Jung, wo man sagt, dass er mit den Nazis geliebäugelt hat oder dass er ihnen nicht genügend…dass er nicht genügend opponiert hat, dass er seinen jüdischen Mitstreitern nicht genügend geholfen hat. Von jüdischer Seite wird ihm ja nie verziehen, dass er mit dem Erzvater gebrochen hat. Das wird ihm als antisemitisch ausgelegt – immer. Und das hat bei mir nicht gezogen, diese ganzen Dinge. Und ich habe mir gesagt: „Ich bin ja nicht dazu da den Jung über den grünen Klee zu loben oder zu verteidigen, sondern: ist das relevant oder ist das nicht relevant?“ Wenn man es vom…Kern der psychologischen Erkenntnisse und Schlüsse von Jung – wohl gemerkt vor zwanzig, 30 Jahren, jetzt würde ich das wahrscheinlich nicht mehr machen – wenn man es von dort beginnend aufzieht, dann ist doch etwas da, glaubte ich. Und wahrscheinlich, für die Zeit würde ich auch dazu stehen. Und ich habe dann ein Buch geschrieben, wo es darum geht, dass man den Jung anwenden kann, wo er…und ich habe dann eine sachte Verbindung zwischen Jung und Marx hergestellt, wobei die Freudianer immer die Verbindung zwischen Freud und Marx dargestellt hatten. Und zwar in der Hinsicht, dass Jung…das, was Marx erkannt hatte, hat Jung auf den Einzelnen bezogen und Marx hat es auf die Masse bezogen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war dann: wie sind diese beiden Pole miteinander in Einklang zu bringen? Kann das eine Parallelaktion sowie bei [Robert] Musil werden, dass der Einzelne versucht die…alienation zu überwinden, aber dass die Politik, die Masse, es gleichermaßen versucht. Also, dass dann irgendwelche führenden Persönlichkeiten, Denker – aber auch nicht nur Dichter oder Denker, sondern Denker und Macher – die alienation auf der großen Bühne überwinden könnten und dass die, unter Umständen, unbedingt sogar, aus dieser Schule hervorgehen sollen, dass sie die alienation bei sich selbst überwunden haben könnten.
5/00:20:34
Dieses Buch habe ich dann auch geschrieben und es ist auch verlegt worden in einem…nicht sehr großen Verlag in Zürich, der bis dahin eigentlich nur diese introvertierten Plaudereien an Schweizer Kaminen verlegt hatte, die dann die Jünger von Jung geschrieben haben. So, wie später Leute über Hitler geschrieben haben. Es hat dann geheißen, es gibt dann auch ein Buch, das heißt Ich war Hitlers Zahnbürste. Und die haben dann geschrieben: „Ich war Carl Gustav Jungs Nachbarin zwei Häuser weiter…“ [Lacht.]
Und er war dann aber bereit, dieses eigentlich ganz und gar politische Buch zu verlegen und hat es auch getan und es sind dann vielleicht ein paar Tausend von den Büchern auch wirklich verkauft worden. Ich muss sagen…und es war auch ein Buch, das über Amerika kritisch gesprochen hat und auch Hitler mit hineingebracht hat und es war, obwohl es nicht viel mehr als 100 Seiten war, it covered a lot of ground. Wie gesagt, ich würde es heute nicht mehr so schreiben und ich würde es vielleicht überhaupt nicht mehr schreiben und ich würde vielleicht auch zu Jung anders stehen heute, aber für damals, finde ich, war es gar nicht schlecht. Es kam zu dem denkbar schlechtesten Augenblick heraus, wie auch das andere vorher. Und zwar…ich meine, das ist nicht eine Entschuldigung dafür: „Wenn das nicht passiert wäre, dann wäre es ein Renner geworden.“ Nein, es wäre nie ein Renner geworden. Aber was passiert war…auch eine meiner Ideen in dem Buch war, dass irgendwann oder irgendwo…sollten die beiden Systeme zusammenkommen. Und ich habe sowjetische Autoren zitiert und amerikanische Autoren zitiert und habe da die Kongruenz und Konfluenz versucht darzustellen. Und das Buch kam im Herbst 1989 heraus. Und damit war das Rennen gelaufen, das Rennen des Renners war gelaufen.
5/00:24:05
Ich habe inzwischen nichts veröffentlicht. Ich habe einerseits eine Novelle geschrieben über besagten Onkel, und zwar habe ich da die Lebensgeschichten meines Vaters und meines Onkels zusammen verarbeitet. Und es sind zwei andere Hauptfiguren in der Novelle: Die eine ist etwas, was ist eine Hitler-Figur…die aber von einem Kriegstagebuch meines Vaters stammt. Er war auf Urlaub in Wien – sie wohnten damals in der Kobenzlgasse – und ging hinauf, wahrscheinlich auf den Kahlenberg, und traf auf dem Kahlenberg einen bayrischen Soldaten. Und es kam eine kurze Konversation zustande und die beiden gingen dann wieder auseinander und der ging in den Krieg und der ging in den Krieg. Er ging an die Mahr und mein Vater ging an die Weichsel. Und ich habe daraus eine Begegnung gemacht: bayrischer Soldat, Hitler und eben der Vater-Onkel-Soldat. Und es ist ein einschneidendes Erlebnis. Die sehen einander nie wieder, aber er glaubt dann…der österreichische Soldat glaubt dann, später, nach der Machtergreifung, wenn er ihn sieht in der Wochenschau, dass das der Mann war. Und er wird dann nach Polen verschickt, in eine Stadt, wo er im Krieg schon war, was ja wahrscheinlich tausendfach passiert ist. Und das ist eine Stadt, die ein polnischer Grande in der Renaissance bauen hat lassen…und außerdem die Geburtsstadt von Rosa Luxemburg und von dem [Jizchok Leib] Perez, von dem jüdischen Dramatiker. Und was sich dort dann abspielt…und dieser Soldat hat dann eine Wiener Freundin, die Tochter eines Gewerkschafters ist, die durch dick und dünn hinkommt nach Polen. Und ihm erscheint an dem Tag, wo er auf dem Hauptplatz steht zum Abtransport. Mir gfollts [gefällt es]! [Lacht.] Aber ich schicke es verschiedenen Leuten und die sagten: „Ja, es ist sehr gut und du müsstest doch einen Agenten finden!“ Aber die Agenten haben bis jetzt nicht angebissen. Das ist eine Sache und dann habe ich noch einen anderen Roman geschrieben mit einem amerikanischen Background und jetzt versuche ich so eine Art Lebenswerk zu schreiben. Und die Idee ist, dass man irgendwie auch publizieren kann. Man bleibt am Ball und man liest und denkt und versucht, vor allem, mit der Zeit mitzugehen, denn sonst hätte es ja gar keinen Sinn. Ich habe einen guten Freund in New York und der schickte mir zum Beispiel zum Geburtstag ein Buch aus seiner Bibliothek mit Doppelconférencen von [Ernst] Waldbrunn und von [Karl] Farkas. Und ich sag mir: „Was, um Gottes Willen, soll ich mit Sachen, die im Simpl [Kabarett in Wien] im Jahre 1955 abgehandelt worden sind und die sich heute so lesen, wie wenn man [Arthur] Schnitzler lesen würde?“ Und ich sage immer: wer stehen bleibt und zurückblickt, der wird…zur Salzsäure.
5/00:29:46
PR: Eine letzte Bitte habe ich noch: kannst du mir bitte noch sagen, wie deine Frau heißt?
GC: Marianne.
PR: Und wann habt ihr euch kennengelernt?
GC: Im Spessart, im Jahr [19]46 wahrscheinlich, [19]47.
PR: Und geheiratet habt ihr dann--
GC: --wir konnten gar nicht, denn amerikanische Soldaten konnten noch nicht, aber wir haben dann im Jahr [19]48 in Garmisch geheiratet und ich habe immer noch den Befehl des Oberkommandierenden, der sagt: „Du musst diese Frau heiraten!“ Es steht nicht so, aber: „Du darfst.“ Wir haben dann eben geheiratet und sind dann zusammen, als Ehepaar, auf einem Truppenschiff in getrennten Abteilen…es gab einen Schlafsaal für Frauen, einen Schlafsaal für Männer, obwohl wir alle schon verheiratet waren. Es war…die Schiffe waren einfach nicht so ausgelegt, es waren nicht einzelne Kabinen.
PR: Euer Sohn ist dann wann auf die Welt gekommen?
GC: [19]59.
PR: [19]59. Gut, ich habe dich jetzt im Groben gefragt, was mir noch in den Sinn gekommen ist. Gibt es irgendwas, das du dem Interview vielleicht noch hinzufügen möchtest, das ich…wahrscheinlich einen Haufen Sachen noch nicht erfragt habe?
GC: Nein, eigentlich, ich wüsste nicht…natürlich, die Tatsache ist, dass es bei uns genauso war wie bei allen anderen. Dass es Großfamilien waren…auf Vaterseite nicht so groß, waren drei Geschwister. Bei meiner Mutter waren es zehn. Und wenn man dann im Stammbaum zurückgeht, dann waren es immer so viele. Und ich habe einen Stammbaum, den anscheinend jemand in Mutters Familie anfertigen hat lassen. Die kamen aus der Slowakei. Und, zum Beispiel, der Großvater hatte, glaube ich, auch acht oder neun Geschwister und die haben dann alle sechs, acht, zehn Kinder gehabt und der Baum biegt sich direkt – und das ist nur ein Teil von dem Stamm. Ich meine, wenn man sich diesen Stammbaum ansieht, der, wie gesagt, nur ein Teil von der Familie ist...wobei, ich muss sagen, die Familie muss gut genug zusammengehalten haben, vor der Nazi-Zeit…dass mir auf den Zweigen…da sind lauter kleine, rote Äpfel an den Zweigen und drinnen ist der Name und das Geburtsjahr…und wenn ich mir diese Namen ansehe, das sind Namen, die ich alle kannte oder fast alle. Ich habe nicht alle gekannt, aber dass es die gab, das wusste ich schon. Weil, sagen wir, eine oder zwei Tanten auch einmal nach Wien kamen und die dann erzählten, dass sie bei der Schwester gewesen waren oder dem Bruder und, dass der gesagt habe, dass der andere Cousin…und diese Leute, die in der Slowakei geblieben waren und nicht nach Wien kamen und die vielleicht nach Ungarn oder in die Tschechoslowakei – nach Tschechien – geheiratet haben, da ist sehr, sehr wenig übriggeblieben. Und wenn man da diesen Stammbaum sieht oder diesen Teil…und man denkt sich, man könnte – was man ja nicht tun will – diese roten Äpfel, sagen wir, schwarz ausfüllen, mit schwarzer Tinte übermalen, dann könnte man schon sehen was aus einer Familie geworden oder eben nicht geworden ist. Und das ist schon ganz, ganz erstaunlich und das macht es dir schon klar.
Es gibt einen mehr oder weniger entfernten Verwandten, das heißt es ist der Mann von einer Cousine meiner Mutter, der ein kleines…eine Broschüre gemacht hat, wo das dann auch drinsteht. Der ist ein gläubiger Jude gewesen und der hat dann auf Hebräisch immer dazu geschrieben, was sie da so sagen…nicht Märtyrertod…oder so etwas Ähnliches, wie das wahrscheinlich in Yad Vashem heißt…dann merkt man schon…ganz schön Gemüte.
5/00:36:48
Das ist es ja, was mich an der ganzen Sache immer noch…ich meine, das wird so sein bis an mein Lebensende…die Idee, dass du eine Heimat nicht hast und nie wiederhaben wirst, denn, ich meine, es gibt Leute, Freunde von mir, die Amerikanerinnen geheiratet haben und die ganz bewusst das alles…einen Schlussstrich gezogen haben. Und das habe ich, entweder Gott sei Dank oder leider nicht getan und meine Frau kann es auch nicht tun. Bei ihr ist die Familie kleiner, die Familie war teilweise irgendwie zerstritten, weil die alle gewetteifert haben als Deutsche deutscher als deutsch zu sein. Wenn einer nur den Verdacht aufkommen ließ, dass er sich irgendwie mit den Juden identifiziert, dann war er schon, für diese Leute, praktisch ein apostate. Und wir waren übrigens auf einem Friedhof in...das hat jetzt alles nichts mehr mit diesen Dingen zu tun.
[Übergang/Schnitt.]
PR: Danke vielmals für das Interview.
[Ende des Interviews.]
|
Image Czuczka in Burggarten, Vienna, around 1928. |
Image Czuczka's father Fritz (1st row, 2nd from right) with his family, Vienna, around 1936. |
Document One of the many publications by Czuczka's father Fritz, Vienna 1926. |
|
Image Czuczka's father Fritz after his release from Buchenwald Concentration Camp, Vienna 1939. |
Image Sketch by Czuczka's father Fritz of his experiences in Buchenwald, New York, around 1941/1942. |
Image Passport of Czuczka's mother Charlotte (pages 2 and 3), Vienna 1939. |
|
Image Czuczka after the end of his military service in Europe and on his way back to the USA, 1948. |
Image Czuczka's wife Marianne in Central Park in New York, around 1950. |
Image Czuczka as the American press attaché, Vienna, around 1972. |
|
Image Czuczka with his wife Marianne and his son Tony in Essen in 1964 when he worked for the Amerikahaus Ruhr (now the Europahaus). |
Image Czuczka and his wife Marianne in front of the Europahaus (formerly the Amerikahaus Ruhr) in Essen, around 2000. |
Image Czuczka, Washington, D.C. 2008. |